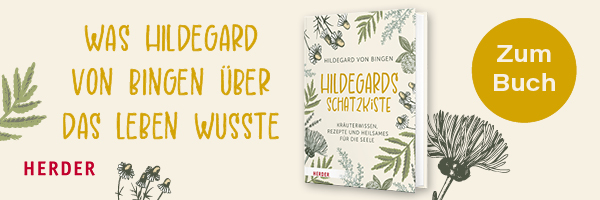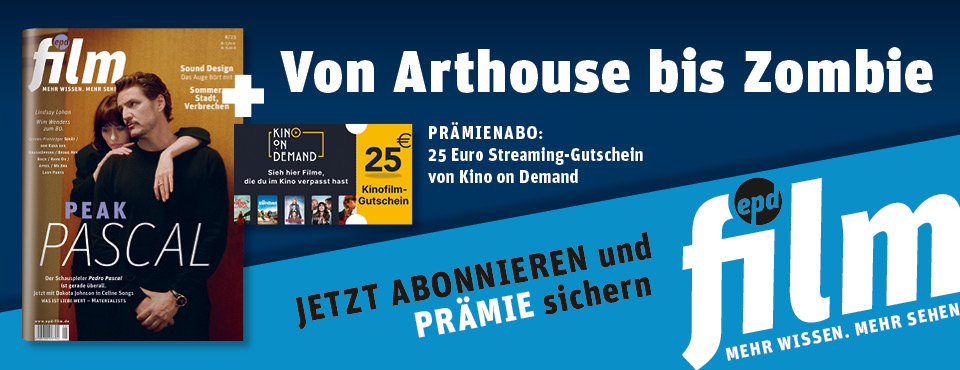evangelisch.de: Das Projekt "Starke Nachbar:innen" läuft seit 2017. Was hat das Projekt in den rund acht Jahren erreicht?
Iyad Asfour: Das Projekt ist inzwischen richtig gut in Neuwied und Umgebung verankert. Es ist ein fester Bestandteil des Integrationskonzepts der Stadt geworden und ergänzt dieses auf wertvolle Weise. Schulen, das Jugendamt und auch viele Nachbarschaftsinitiativen greifen regelmäßig auf unser Angebot zurück. Das zeigt uns, wie groß der Bedarf ist. Ein großer Pluspunkt ist, dass es dem Projekt gelingt, Menschen aus ganz unterschiedlichen Kulturen zusammenzubringen und den Austausch zu fördern. Es geht nicht nur um kurzfristige Hilfe, sondern um den Aufbau langfristiger, stabiler Strukturen. Damit das auch so bleibt, setzen wir besonders auf die Ausbildung von Konfliktvermittler:innen und auf nachhaltige Netzwerke im Stadtteil.
Wie funktioniert dieses Netzwerk?
Asfour: Das Herzstück des Projekts ist der Peer-to-Peer-Ansatz: Menschen, die selbst einmal als Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind oder schon länger hier leben, helfen Neuankommenden bei der Orientierung im Alltag – mit ganz praktischen Tipps und persönlicher Begleitung. Was das Projekt besonders macht, ist die intensive Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden, die eigene Fluchterfahrung mitbringen. Das schafft Vertrauen und baut Hürden ab. Uns geht es darum, Geflüchtete zu unterstützen und gemeinsam ein Miteinander zu schaffen, in dem jede und jeder eine Stimme hat und einen Beitrag leisten kann. Die Geflüchteten werden nicht nur begleitet, sondern sie gestalten aktiv mit. So entstehen Brücken zwischen Kulturen, echte Begegnungen und Lösungen auf Augenhöhe.
EIRENE ist eine internationale Friedensorganisation, die solche Konzepte normalerweise in Krisenregionen im Ausland umsetzt. Lässt sich das einfach so auf den Alltag in Deutschland übertragen?
Asfour: "Starke Nachbar:innen" ist tatsächlich das erste Projekt von EIRENE in Deutschland, das auf Methoden der zivilen Konfliktbearbeitung setzt. Es geht darum, Konflikte frühzeitig zu erkennen und gemeinsam auf Augenhöhe zu lösen. Hier im städtischen Alltag funktionieren diese Methoden gut. Der große Unterschied liegt im Umfeld: In Deutschland haben wir stabile Strukturen und staatliche Unterstützung, was vieles erleichtert. Trotzdem gibt es auch hier Spannungen, Missverständnisse oder Vorurteile. Auch hier braucht es also Räume und Werkzeuge, um ein friedliches Zusammenleben zu fördern.
Können Sie anhand eines Beispiels aus Neuwied zeigen, wie die Methode der "starken Nachbarschaften" integrierend wirkt?
Asfour: Ein besonders schönes Beispiel ist die Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirchengemeinde in Niederbieber. Dort finden regelmäßige Willkommensrunden statt. Menschen aus der Nachbarschaft und Geflüchtete kommen zusammen, kochen gemeinsam, tauschen sich aus und planen kleine Aktionen. Die Kirche wird dadurch zu einem offenen Treffpunkt, an dem nicht nur Hilfe, sondern auch echte Begegnung stattfindet. Das schafft Vertrauen und zeigt: Integration passiert dann, wenn Menschen sich wirklich begegnen. Die Kooperation mit dem Diakonischen Werk im Kirchenkreis Wied stärkt das Ganze zusätzlich, weil so noch mehr Angebote entstehen und sich die Netzwerke verbreitern.
Und welche Wirkung hat das auf der persönlichen Ebene, sowohl auf Einheimische als auch auf Migrant:innen?
Asfour: Wenn Geflüchtete sich ehrenamtlich engagieren, beispielsweise bei einer Stadtteil-Aktion oder als Konfliktvermittler:innen, dann erleben sie, dass sie Teil der Gemeinschaft sind. Sie erfahren Wertschätzung, gewinnen Selbstvertrauen und finden ihren Platz. Gleichzeitig verändert sich dadurch auch die Wahrnehmung der Einheimischen. Geflüchtete werden nicht mehr als "Hilfesuchende" wahrgenommen, sondern als aktive Mitmenschen, die sich einbringen. So entstehen Respekt und Augenhöhe. Vorurteile schwinden.
Welche Vorurteile und fremdenfeindlichen Herausforderungen gab es im Rahmen des Projekts?
Asfour: Natürlich gab es anfangs auch Vorbehalte. Manche hatten Angst vor dem "Fremden" oder wollten keinen Kontakt zu Geflüchteten. Auch unter den Geflüchteten selbst kam es hin und wieder zu Spannungen. Aber genau da setzt unser Projekt an. Wir schaffen Gesprächsräume, bauen Brücken und fördern ein friedliches Miteinander, in dem man sich gegenseitig versteht – auch wenn es mal schwierig wird.
"Wenn Menschen die Möglichkeit haben, sich einzubringen, entsteht echte Veränderung"
Welche Rolle spielte das nachbarschaftliche Konzept bei solchen Reaktionen?
Asfour: Dabei ist das nachbarschaftliche Konzept zentral. Es geht nicht nur um Integration im klassischen Sinne, sondern darum, den Alltag gemeinsam zu gestalten. Wenn man gemeinsam kocht, Müll sammelt oder diskutiert, verschwinden viele Vorurteile wie von selbst. Es entsteht Nähe, und die Menschen erleben: Wir sind Nachbarn – mit ähnlichen Sorgen, Wünschen und Stärken. Diese alltäglichen Begegnungen schaffen Vertrauen und machen Integration lebendig.
Welche Lerneffekte nehmen Sie aus diesem Projekt mit?
Asfour: Was wir ganz klar gelernt haben: Integration ist keine Einbahnstraße. Sie lebt von gegenseitigem Respekt und Begegnung auf Augenhöhe. Und sie braucht Zeit. Oft sind es die kleinen Dinge, die den Unterschied machen: ein Gespräch, ein gemeinsames Essen oder eine Einladung zur Beteiligung. Wenn Menschen die Möglichkeit haben, sich einzubringen, passiert echte Veränderung.
Gibt es dieses Projekt nur in Neuwied oder auch anderswo?
Asfour: Im Moment läuft das Projekt in Neuwied in enger Zusammenarbeit mit der Diakonie. Das Konzept lässt sich aber auch an anderen Orten umsetzen. Erste Gespräche dazu finden bereits statt. So etwa mit der Stadt Unkel, die etwa 20 Kilometer entfernt liegt. Unser Ziel ist es, weitere starke Nachbarschaften aufzubauen – und die positiven Erfahrungen aus Neuwied in andere Städte zu tragen.