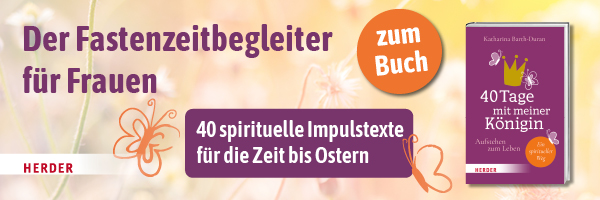Den meisten Menschen kann im Krankenhaus geholfen werden, aber natürlich nicht allen. Gerade auf der Intensivstation ist der Tod ein ständiger Begleiter. Die Frage ist allerdings, wie die Beteiligten damit umgehen: Stellen sie sich dieser unvermeidlichen Tatsache oder versuchen sie, sie zu ignorieren? Wie kann es gelingen, potenziell erschütternde Erlebnisse hinter sich zu lassen? Und welche Folgen hat es, wenn sich zur täglichen Überlastung auch noch private Probleme gesellen?
Im Mittelpunkt des ersten Films mit Lou Strenger als Psychotherapeutin, die sich an einem Essener Klinikum um die seelische Gesundheit des Personals kümmern soll, stand das Schicksal eines Intensivpflegers. Der zweite spielt zehn Wochen später. Nun geht es um seinen Chef: Schon in "Therapie und Praxis" war Robert Schultholz (Carlo Ljubek) wenig kooperativ, obwohl das Arbeitsklima in seiner unterbesetzten Abteilung offenkundig miserabel ist, wie der giftige Grünstich der Bilder suggeriert. Dank eines cleveren Schachzugs hat Dina Schwarz, Arbeitsmotto: "Dein Ego ist nicht dein Amigo", dafür gesorgt, dass ihm zwei weitere Stellen genehmigt werden.
An seinem persönlichen Stress kann der Arzt jedoch nur selbst etwas ändern. Mit simplen, aber wirkungsvollen Mitteln der Bildgestaltung verdeutlichen Regisseur Janosch Chávez-Kreft und sein Kameramann Timm Lange, wie ihm die Belastung zusetzt. Die Tonspur trägt ebenfalls ihren Teil dazu bei, Schultholz als Getriebenen darzustellen: Der Arzt ist am Ende seiner körperlichen und geistigen Kräfte.
Tilmann P. Gangloff setzt sich seit 40 Jahren als freiberuflicher Medienkritiker unter anderem für "epd medien" mit dem Fernsehen auseinander. Gangloff (geb. 1959) ist Diplom-Journalist, Rheinländer, Vater von drei erwachsenen Kindern und lebt am Bodensee. Er war über 30 Jahre lang Mitglied der Jury für den Grimme-Preis, ist ständiges Mitglied der Jury Kindermedien beim Robert-Geisendörfer-Preis, dem Medienpreis der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), und 2023 mit dem Bert-Donnepp-Preis für Medienpublizistik ausgezeichnet worden.
Maike Rasch hätte die Handlung von "Wahrheit oder Pflicht" auch als medizinischen Krimi konzipieren können: Als es Schultholz trotz intensivster Anstrengungen nicht gelingt, einen Patienten zu reanimieren, besteht die Witwe auf einer Obduktion. Der Zustand ihres Mannes galt als stabil; sie will wissen, ob ein Behandlungsfehler zu seinem Tod geführt hat. Die Autopsie bestätigt zwar die Herzinfarktdiagnose, aber der Fall wird trotzdem untersucht, denn zur Ursachenforschung kann die Leichenschau nichts beitragen. Im Grunde ist der tragische Exitus jedoch nur ein Mittel zum Zweck: Das Drehbuch konzentriert sich auf die fast schon feindselige Haltung des Arztes gegenüber der Psychotherapeutin, die verstehen will, warum er jede Hilfe ablehnt.
Wie schon in "Therapie und Praxis" beschreiben regelmäßig eingespielte Podcast-Zitate die Bedingungen, unter denen die Belegschaft arbeiten muss. Dinas Gesprächspartnerin ist diesmal Ella Kroll (Kübra Sekin), die Oberärztin der psychiatrischen Abteilung. Sie spricht unter anderem über das selbstzerstörerische Verhalten vieler Kolleginnen und Kollegen, die den Stress mit Alkohol und Tablettenmissbrauch bekämpfen. Unter anderem ist es auch ihren Aussagen zu verdanken, dass Schultholz nicht als herzloser Unhold erscheint, obwohl Carlo Ljubek ihn mit einer fast schon zynisch anmutenden Fassade versieht. Rasch gewährt ihm außerdem mildernde Umstände: Der geschiedene Arzt kommt ständig zu spät, um seine Kinder abzuholen, und hat Angst, das Sorgerecht zu verlieren.
Parallel dazu erzählt der Film, wie sich Dinas Verhältnis zu ihrer Chefin entwickelt. Erneut sind es gerade die beiläufig eingestreuten kleinen Momente, die andeuten, dass Klinikleiterin Jelinek (Ulrike C. Tscharre) ihrer scheinbar harschen Haltung zum Trotz große Sympathie für die Therapeutin empfindet, selbst wenn sie die Wahl ihrer gern unkonventionellen Mittel nicht immer gutheißt. Für Auflockerungen jenseits des ernsten Themas sorgen Dinas Geplänkel mit ihrem Assistenten Anton (Andreas Schröders), der schließlich ein verblüffendes Geheimnis lüftet, sowie die private Ebene.
Das gilt nicht nur für die Gespräche mit ihrem besten Freund und Kollegen Gabriel (Denis Schmidt), der ihr moralisches Gewissen verkörpert: Ihre 25jährige Schwester Kiki (Amelie Gerdes) hat das Down-Syndrom und lebt noch zuhause, will aber endlich ein selbstbestimmtes Leben führen und steht eines Tages mit einem Koffer vor der Tür. Dass die Mutter eine Leerstelle des Films bildet, bietet sicher Potenzial für weitere Filme, ebenso wie die Beziehung zu Intensivpfleger Adem (Sohel Altan Gol), der nicht nur wegen seiner Zuneigung zu Dina hin und her gerissen ist: Loyalität und Vertrauen sind die Basis einer gedeihlichen Zusammenarbeit; aber auch er will wissen, ob der Patient aufgrund eines Fehlers gestorben ist. Der WDR beantwortet die Frage, ob es weitere Filme geben wird, jedoch nur ausweichend; vermutlich will die ARD erst mal abwarten, wie gut sie ankommen.