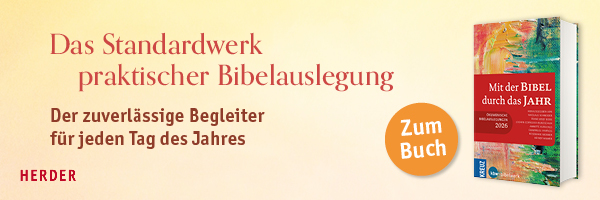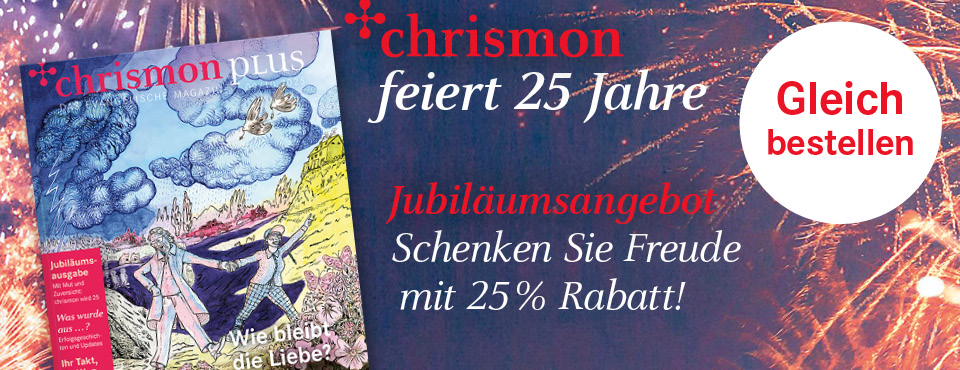Mit den Betreibern der Tongruben im Westerwald hatte Jörg Hilgers von der rheinland-pfälzischen Stiftung für Natur und Umwelt eine gut eingespielte Kooperation: An allen Abbauflächen wurden für den Amphibienschutz immer auch zeitweilige Tümpel angelegt, um die Bestände von seltenen Gelbbauchunken und Laubfröschen zu bewahren. Doch in jüngster Vergangenheit spüren die Naturschützer immer stärker die Auswirkungen des Klimawandels. "Seit 2019 müssen wir alles komplett neu denken", berichtet Hilgers bei einer Tagung des Landesumweltamtes in Mainz. Die Wasserflächen seien immer öfter ausgetrocknet. "Wir bauen jetzt Kaskadensysteme, die hintereinandergeschaltet sind, so dass zumindest in einem Bereich immer noch Wasser steht."
Längst beeinträchtigt der Klimawandel spürbar auch die Ökosysteme in Mitteleuropa. Biotope gehen verloren. Der vielerorts sinkende Grundwasserspiegel gefährdet den Fortbestand der angestammten Vegetation. Arten, die auf kühleres Klima angewiesen sind, werden zunehmend verdrängt. Die Entwicklungszyklen aufeinander angewiesener Pflanzen, Insekten und Vogelarten passen nicht mehr zueinander.
Eckhard Jedicke, Landschaftsökologe an der Hochschule Geisenheim in Hessen, hält mittlerweile ein ganz grundsätzliches Umdenken im Naturschutz für unumgänglich. Die in der Europäischen Union weiterhin maßgebliche Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie von 1992 fordere von den Mitgliedsstaaten den Erhalt der einheimischen natürlichen Lebensräume. Doch längst gebe es eine Vielzahl von Projekten, die unrealistische Ziele verfolgten, warnt er: "Damit verpufft ein großer Teil der Energie des Naturschutzes."
Faktisch würden aufgrund des Klimawandels bereits neuartige Ökosysteme entstehen. Beispielhaft sei die Situation der Buchenwälder, die einst in weiten Teilen Deutschlands die natürliche Vegetation bildeten, und zu deren Schutz ganz besonders auch die Bundesrepublik verpflichtet ist. Naturbelassene Buchenwälder galten lange als ökologisch wertvoller Gegenentwurf zu den von der Forstwirtschaft angelegten Fichten-Monokulturen.
Buchen? Die müssen Sie weiter oben suchen
Doch in Regionen wie Baden-Württemberg könnte sich die Buche in absehbarer Zukunft auf Standorte oberhalb von 550 bis 600 Metern zurückziehen, zitiert Jedicke aus einer aktuellen Studie. "Das primäre Ziel ist mittlerweile, überhaupt Wald zu erhalten", sagt der Forscher. Im Zweifelsfall sei das selbst dann besser, wenn beim Waldumbau verstärkt auf Arten zurückgegriffen wird, die traditionell nicht in der Region heimisch sind. Bei manchen Artenschutzprojekten sei es wohl ebenfalls unvermeidlich, "bye bye zu sagen", um knappe Ressourcen zu bündeln.
Auch Jörg Hilgers glaubt mittlerweile, dass es wichtiger ist, naturnahe Lebensräume zu bewahren, als sich dem unaufhaltsamen Verlust einzelner Arten entgegenzustemmen. Mancherorts versucht seine Stiftung mit ihren Projekten trotzdem das scheinbar Unmögliche - so wie beim extrem seltenen Mosel-Apollofalter, der nur noch in vier kleinen Arealen entlang des Flusses vorkommt.
Die Aufgabe vieler Weinberge, das Fehlen von Blühpflanzen in trockenen Jahren und möglicherweise auch Pestizid-Einsatz haben die Art an den Rand des Aussterbens gebracht. Umweltschützer versuchen mittlerweile, in einem Seitental der Mosel einen neuen Lebensraum für die Schmetterlinge zu schaffen.
Erste Versuche mit Raupen aus einer Erhaltungszucht seien vielversprechend angelaufen: "Wir sind da optimistisch gestimmt, dass es greifen und funktionieren kann."
Nach der Ahrtalflut ist auch die Natur eine andere
Noch vor ganz anderen Herausforderungen stehen Naturschützer in Regionen, die von Extremwetter-Ereignissen zerstört wurden - wie etwa im Ahrtal. Wegspülte Uferbereiche, verwüstete Auenwälder, Unmengen Müll und ungeklärter Abwässer haben die Ahr dramatisch verändert, schildert Raik Schmidt von der örtlichen Umweltbehörde. "Es war nicht mehr möglich, im Zuge der Wiederaufbauarbeiten geregelte Genehmigungsverfahren durchzuführen", sagt er. Selbst die Landschaft im Tal hat sich teils deutlich verändert, wobei sogar neue Biotope entstanden sind. Die Umweltbehörde stehe nun vor dem Dilemma, die neuen Lebensräume zu bewahren, andererseits aber bleibe die Pflicht, den Ursprungszustand von vor 2021 wieder herzustellen.