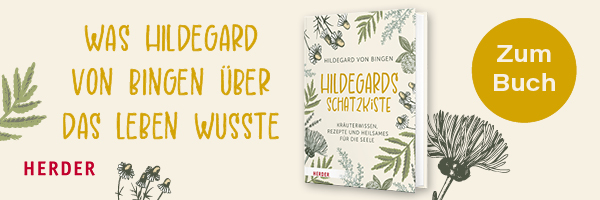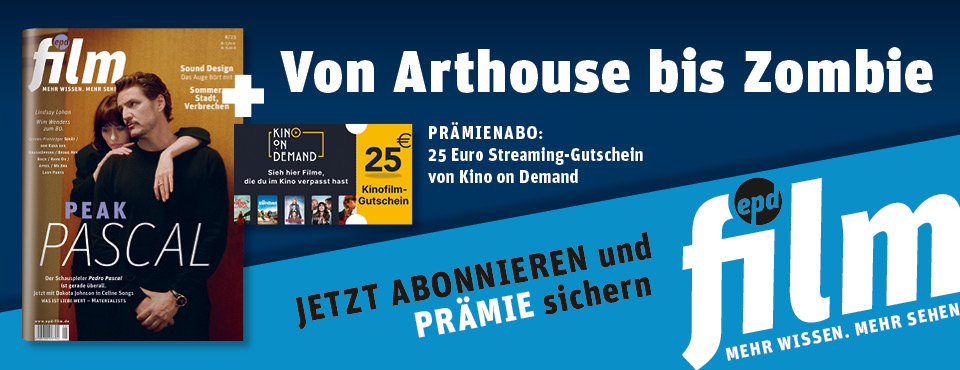Vorurteil 1: Migranten nehmen Deutschen Arbeitsplätze weg
Fakten-Check:
Über mehrere Jahre betrachtet sinkt die Arbeitslosenquote unter Geflüchteten. Viele arbeiten in Branchen mit Personal- und Fachkräftemangel. Zahlen der Bundesagentur für Arbeit zeigen: Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist relativ niedrig. Zugewanderte oder Geflüchtete verdrängen keine arbeitenden Deutsche aus ihren Jobs, sondern ergänzen viel mehr den Arbeitsmarkt.
Mehr als 60 Prozent der Geflüchteten, die 2015 nach Deutschland kamen, sind nach Angaben des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) heute erwerbstätig. Sie zahlen Steuern und Sozialabgaben und helfen, Probleme auf dem Arbeitsmarkt zu lösen. Ob in der Pflege, Gastronomie oder Logistik – in zahlreichen Arbeitsfeldern finden Unternehmen nicht genügend Personal. Deutschland altert, Arbeitskräfte gehen verloren: Ohne Zuwanderung wäre das Problem noch größer.
So können Sie antworten:
Geflüchtete nehmen Deutschen die Jobs weg? Das entspricht nicht den Tatsachen. In Deutschland gibt es viele offene Stellen, Firmen suchen händeringend Auszubildende. Ob Krankenhäuser, Handwerksbetriebe, Gasthäuser oder in der Logistik: Zugewanderte übernehmen häufig Jobs, auf die sich kaum jemand bewirbt. Wir haben mehr Rentner als Nachwuchs. Langfristig profitieren Wirtschaft und Gesellschaft von den Leistungen und Beiträgen der Menschen, die nach Deutschland kommen.
Vorurteil 2: Flüchtlinge sind oft kriminell
Fakten-Check:
Die Zuwanderung seit 2015 hat nicht zu einem flächendeckenden und dauerhaften Anstieg der Kriminalität geführt. Empirische Studien stellen vor allem bei Eigentumsdelikten teils zeitlich und teils regional begrenzte Anstiege fest. Statistiken zeigen, dass Geflüchtete in vielen Deliktbereichen nicht krimineller sind die Gesamtbevölkerung.
In der Polizeilichen Kriminalstatistik fällt auf, dass bei allen Bevölkerungsgruppen junge Männer im Übergang vom Jugend- zum Erwachsenenalter überrepräsentiert sind. Da der Anteil junger Männer bei Geflüchteten überdurchschnittlich hoch ist, schlagen Alltagsdelikte (z.B. Diebstahl, Schwarzfahren, Körperverletzung) und Sexualstraftaten in den Statistiken häufiger zu Buche. Faktoren wie mangelnde finanzielle Mittel, eine prekäre Wohnsituation oder eine geringe soziale Einbindung führen oftmals zu Eigentums- und Gewaltdelikten. In Aufnahmeeinrichtungen finden zudem häufiger Polizeikontrollen statt.
Und Menschen mit ausländischem Aussehen werden häufiger von der Polizei kontrolliert. Die Folge: Delikte werden bei Migranten häufiger erfasst. In die Statistik fließen auch ausländerrechtliche Vergehen mit ein, die Bundesbürger:innen nicht begehen können. Die polizeiliche Statistik erfasst Tatverdächtige, nicht Verurteilte. Für kriminelles Verhalten sind nicht Herkunft oder Fluchtgeschichte entscheidend, sondern in der Regel Alter, Geschlecht und soziale Lage.
So können Sie antworten:
Wer behauptet, kriminelles Verhalten hängt mit der Herkunft oder Nationalität zusammen, liegt total daneben. Studien zeigen, dass Geflüchtete bei den meisten Delikten nicht krimineller sind als die Gesamtbevölkerung. Viele werden zudem aus einer sozialen Notlage heraus straffällig. Die allermeisten Zugewanderten halten sich an Recht und Gesetz. Ob jemand straffällig wird, hängt vor allem mit Alter, Geschlecht oder der sozialen Lage zusammen - egal ob mit oder ohne Migrationshintergrund. Wer Geflüchtete pauschal als Kriminelle abstempelt, schürt Vorurteile und tut sehr vielen Menschen Unrecht.
Vorurteil 3: Geflüchtete wollen sich nicht integrieren
Fakten-Check:
Mehr als 80 Prozent der Geflüchteten nehmen an Integrations- und Sprachkursen teil, zwei Drittel der seit 2015 Eingereisten haben bis 2021 einen Integrationskurs erfolgreich abgeschlossen und Deutsch gelernt, stellt ein OECD-Bericht fest. Laut Statistischem Bundesamt hatten nach fünf Jahren mehr als 50 Prozent der erwerbsfähigen Geflüchteten eine Beschäftigung oder machten eine Ausbildung.
Auch gesellschaftlich engagieren sich viele. Eine Analyse des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) stellt fest: Eine große Mehrheit der Zugewanderten nutzt Kindergärten und Schulen, viele engagieren sich in Vereinen. Integrationshindernisse beruhen nicht auf mangelnden Willen, stellen Studien der Bertelsmann Stiftung und das Sozio-oekonomische Panels (SOEP) fest: Integration wird in der Regel durch strukturelle Hürden erschwert wie zum Beispiel Sprachbarrieren, Kinderbetreuung, die Anerkennung von Abschlüssen oder Diskriminierung.
So können Sie antworten:
Integration braucht Zeit. Das geschieht oft leise im Alltag und Schritt für Schritt. Die meisten Geflüchteten und Zugewanderten möchten sich in Deutschland integrieren: Sie besuchen Sprach- und Integrationskurse, suchen Arbeit und engagieren sich oft auch ehrenamtlich. Je länger sie hier sind, desto häufiger finden sie auch Jobs und zahlen Steuern. Wenn es mit der Integration hakt, liegt das selten am fehlenden Willen. Stolpersteine sind gesellschaftliche Vorurteile, zu wenig Sprachförderung, fehlende Kinderbetreuung oder dass ausländische Schul- und Berufsabschlüsse nicht anerkannt werden.
Vorurteil 4: Geflüchtete haben keinen Respekt vor Frauen
Fakten-Check:
Unter Geflüchteten gibt es kulturelle Unterschiede in den Einstellungen zu Geschlechterrollen. Doch die Mehrheit akzeptiert die deutschen Grundrechte. Integrationskurse vermitteln diese Werte und eine repräsentative Umfrage des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) zeigt, dass 92 Prozent der Geflüchteten Frauenrechte unterstützt. In den Einstellungen zur Gleichberechtigung bestehen nur geringe Unterschiede zwischen Geflüchteten und Deutschen. Grobe Verstöße sind Einzelfälle und werden strafrechtlich verfolgt.
In Kriminalstatistiken zur sexualisierten Gewalt ist der Anteil von Tatverdächtigen mit Migrationshintergrund in einzelnen Jahren erhöht. Laut Bundeskriminalamt erklären sich diese Straftaten jedoch überwiegend durch demografische Faktoren wie Alter, Geschlecht und soziale Lage. Die meisten Tatverdächtigen sind Deutsche. Medienberichte verzerren oft die Wahrnehmung und verbreiten Stereotypen: Auffällig ist, dass bei Straftaten eine Staatsangehörigkeit oder ein Migrationshintergrund meist in den Fällen genannt wird, wenn es eine nichtdeutsche Person betrifft.
So können Sie antworten:
Einige Geflüchtete bringen traditionellere Rollenbilder mit. Doch das heißt nicht, dass sie Frauen nicht respektieren. Studien zeigen: Die große Mehrheit unterstützt Gleichberechtigung und lebt diese Werte. Integrationskurse vermitteln das Grundgesetz, inklusive Frauenrechte. Und die werden von fast allen beachtet. Es gibt Fälle von sexualisierter Gewalt. Doch Kriminalstatistiken zeigen, dass die meisten Täter Deutsche sind, nicht Geflüchtete. Faktoren wie Alter, Geschlecht und soziales Milieu spielen dabei eine größere Rolle als die Herkunft. Es ist nicht fair, wegen dem Fehlverhalten von Einzelnen alle Zugewanderten unter Generalverdacht zu stellen.
Vorurteil 5: Geflüchtete verstärken Antisemitismus in Deutschland
Fakten-Check:
Antisemitische Vorfälle haben in Deutschland seit 2015 insgesamt zugenommen, besonders stark seit Herbst 2023 nach dem Angriff der Hamas auf Israel. Die Ursachen sind vielschichtig, betont ein Bericht des Verfassungsschutzes: Rund die Hälfte der antisemitischen Straftaten stammen aus dem rechtsextremen Milieu. Seit Oktober 2023 verzeichnen die Behörden zudem vermehrt Taten von Gruppen, die religiös-politisch motiviert sind, insbesondere im Zusammenhang mit pro-palästinensischen Protesten.
Das Bundeskriminalamt weist darauf hin, dass die Täter aus unterschiedlichen sozialen und politischen Milieus kommen. Umfragen zeigen: Antisemitische Einstellungen finden sich bei Menschen mit und ohne Migrationshintergrund. Die Herkunft allein erklärt antisemitische Einstellungen nicht, eine größere Rolle spielen Alter, Bildung und Religiosität. Für gewalttätigen Antisemitismus gilt laut Bundeskriminalamt: Die größte Gefahr geht von der rechtsextremen Szene aus, während islamistische und andere politisch motivierte Täter kleinere, aber relevante Anteile ausmachen. Es ist falsch, Geflüchtete pauschal als Treiber von Antisemitismus zu bezeichnen.
So können Sie antworten:
Geflüchtete pauschal für mehr Antisemitismus verantwortlich zu machen, ist falsch. Antisemitische Sichtweisen gibt es überall - bei Deutschen genauso wie bei Zugewanderten. Entscheidend ist nicht, wo jemand herkommt. Ob jemand antisemitisch drauf ist, hängt oft damit zusammen, wie alt jemand ist, wie gut die Person gebildet ist und in welchem sozialen Umfeld sie lebt. Fakt ist auch: Die meiste antisemitische Gewalt geht von Rechtsextremen aus. Viele Geflüchtete setzen sich aktiv gegen Antisemitismus ein.
Vorurteil 6: Es kommen nur junge Männer
Fakten-Check:
Die Behauptung ist viel zu pauschal. Geschlecht und Alter der Geflüchteten verändern sich je nach Jahr, Herkunftsregion und Fluchtbewegung. 2015 waren nach Angaben des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) rund 69 Prozent der Asylsuchenden männlich. Junge Männer nahmen häufiger riskante und teure Fluchtrouten auf sich, während Frauen und Ältere seltener unterwegs waren.
Mit der Fluchtwelle aus der Ukraine änderte sich das Bild im Jahr 2022 deutlich. Diesmal kamen überwiegend Frauen und Kinder nach Deutschland, wie das ifo Institut berichtet. 2023 nahm wieder der Anteil jüngerer Männer (16 bis 40 Jahre) zu, stellt das BAMF fest. Der jährliche Migrationsbericht der Bundesregierung betont, dass es keine typische Gruppe von Geflüchteten gibt. Die Alters- und Geschlechterprofile sind vielschichtig: Kinder, Jugendliche, Frauen, Männer. Sie ändern sich je nach Fluchtroute und Möglichkeiten der Migration. Die Zahlen zeigen: Migration ist vielfältig, dynamisch und keinesfalls so einseitig, wie es manche darstellen.
So können Sie antworten:
Wer glaubt, Geflüchtete seien nur junge Männer, liegt daneben. Die Jahre 2015 und 2016 prägten zwar Bilder von jungen Männern, die vor dem Krieg in Syrien bis nach Deutschland flohen. Aber die Zusammensetzung der Geflüchteten hat sich seitdem deutlich verändert. Familien zogen nach. Und 2022 kamen aus der Ukraine vor allem Frauen und Kinder. Heute ist die Alters- und Geschlechterverteilung viel bunter gemischt. Es gibt nicht die "typische Gruppe". Wer pauschal urteilt, übersieht die Vielfalt der Menschen, die in Deutschland Zuflucht suchen.
Vorurteil 7: Die Integration ist gescheitert
Fakten-Check:
Mehr als 60 Prozent der seit 2015 zugezogenen Geflüchteten sind heute entweder berufstätig, in Ausbildung oder engagieren sich ehrenamtlich. Auch die Kinder vieler Geflüchteter besuchen erfolgreich Schulen und schließen diese ab, berichtet das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB).
Hürden bestehen weiterhin: Sprachbarrieren und Probleme bei der Anerkennung ausländischer Abschlüsse erschweren den Einstieg in den Arbeitsmarkt, stellt das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) fest. Eine Bilanz zur Wirkung der Integrationskurse fällt gemischt aus: Vielen helfen die Kurse beim Deutschlernen. Doch hohe Abbruchquoten zeigen, dass in der Praxis die Sprachförderung und Betreuung noch verbessert werden müssen.
In der Kriminalstatistik sind Menschen mit Migrationshintergrund bei einigen Deliktarten häufiger vertreten. Das Bundeskriminalamt betont jedoch, dass dies stark durch Alter, soziale Lage und polizeiliche Ermittlungsmethoden beeinflusst wird. Insgesamt sind Rückschläge und Herausforderungen festzustellen. Es gibt aber auch nachweislich Fortschritte in Bereichen wie etwa Arbeit, Bildung und gesellschaftliche Teilhabe.
So können Sie antworten:
Integration ist kein Sprint, sondern ein Marathon mit Höhen und Tiefen. Von den Geflüchteten, die 2015 kamen, haben die meisten Jobs gefunden und lernen Deutsch. In Schulen, Betrieben und Nachbarschaften entstehen Begegnungen und Freundschaften. Natürlich gibt es noch Baustellen. Ausländische Abschlüsse werden oft nicht anerkannt, Vorurteile erschweren die Wohnungs- und Jobsuche, es bräuchte mehr Sprachkurse. Es gibt also Fortschritte und Rückschläge. Von einem "Scheitern" kann keine Rede sein.
7 Tipps für den Umgang mit populistischem Gerede
1. Ruhig bleiben
• Lass dich nicht provozieren.
• Sprich sachlich, ohne Spott oder Wut.
2. Nachfragen
• Frage nach: "Woher hast du das?" / "Meinst du wirklich alle?"
• Mit Verständnisfragen regst du zum Nachdenken an.
3. Eigene Haltung zeigen
• Sage klar: "Ich sehe das anders."
• Nutze persönliche Erfahrungen + wenige Fakten.
• Beruf dich auf gemeinsame Werte (Fairness, Mitmenschlichkeit).
4. Publikum im Blick behalten
• Antwort nicht nur für den Populisten, sondern auch für stille Zuhörer.
• Mach deutlich, dass Vorurteile nicht unwidersprochen bleiben.
5. Realistische Ziele setzen
• Du musst niemanden komplett überzeugen.
• Schon Zweifel säen oder Differenzierung zeigen ist ein Erfolg.
6. Grenzen ziehen
• Wenn es aggressiv oder respektlos wird: Gespräch freundlich beenden.
• Wichtig: Deine Sicherheit und Energie stehen an erster Stelle.
7. Nach dem Gespräch
• Für sich reflektieren: Was war gut, was belastend?
• Freu dich darüber, dass du Haltung gezeigt hast.