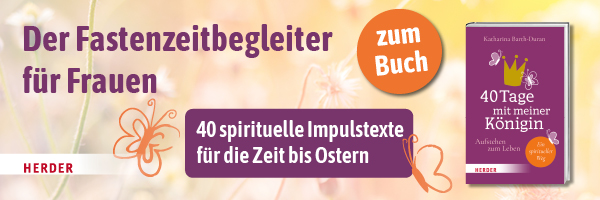Vor ein paar Wochen wurde eine wichtige Studie über das bedingungslose Grundeinkommen veröffentlicht. 107 Menschen in ganz verschiedenen Lebenslagen haben drei Jahre lang jeden Monat jeweils 1.200 Euro geschenkt bekommen. Ohne Bedingungen: Sie konnten damit machen, was sie wollten. Finanziert wurde das von einem privaten Verein. Der setzt sich dafür ein, dass der Staat allen Menschen ein bedingungsloses Grundeinkommen – abgekürzt: BGE – auszahlt.
Zugleich findet in Deutschland wieder eine Faulenzerdebatte statt. Die künftige Bundesregierung möchte einerseits Menschen stärker helfen, in Arbeit zu kommen. Andererseits rufen Politiker, aus der Union wie aus der SPD, nach "schärferen Sanktionen gegen Totalverweigerer": Wer arbeiten kann und es nicht tut, denen soll die Unterstützung "schneller" ganz gestrichen werden.
Alexander Maßmann wurde im Bereich evangelische Ethik und Dogmatik an der Universität Heidelberg promoviert. Seine Doktorarbeit wurde mit dem Lautenschlaeger Award for Theological Promise ausgezeichnet. Publikationen in den Bereichen theologische Ethik (zum Beispiel Bioethik) und Theologie und Naturwissenschaften, Lehre an den Universitäten Heidelberg und Cambridge (GB).
Wenn es sich manche auf der Hängematte bequem machen, kann der Staat doch niemals das BGE zahlen, so scheint es! Oder sind die Menschen doch nicht so fürchterlich faul? 2024 waren in Deutschland so viele wie nie zuvor erwerbstätig, und schon 2023 war ein neuer Rekord aufgestellt worden. Hier stimmt etwas nicht! Das zeigt auch die neue Studie zum BGE. Was ist dabei herausgekommen, und was ist vom BGE zu halten?
Was ist das BGE?
Mit dem BGE bekommen alle Menschen jeden Monat eine bestimmte Summe geschenkt – z.B. Erwachsene 1.200 Euro und Kinder die Hälfte. Man muss keine Bedürftigkeit nachweisen und die Zahlung auch nicht zurückzahlen oder abarbeiten. Mehr erfährt man zum Beispiel in einer eindrucksvollen Doku des RBB.
In der Schweiz ist es 2016 sogar zu einer Volksabstimmung über das BGE gekommen, in der etwa ein Viertel der Beteiligten dafür stimmten. Anders als im Schweizer Modell diskutiert die deutsche Studie ein Verfahren, in dem alle unabhängig von einem anderweitigen Verdienst einen festen Betrag erhalten. Wer nach diesem Modell 3.000 Euro verdient, hat mit BGE etwa 4.200 in der Tasche.
Wie viel davon besteuert wird, wäre zu diskutieren. Steuern sind ohnehin ein wesentliches Thema für die Finanzierung des BGE. Meist wird eine Finanzierung über die Einkommenssteuer diskutiert. Bei den mittleren Einkommen würde die Steuerbelastung das BGE in etwa wieder auffressen. Während die kleinen Einkommen netto profitieren würden, müssten Leute mit hohen Einkommen mehr zahlen als zuvor, aber keineswegs dramatisch mehr. Ich finde außerdem, man sollte in Deutschland durchaus auch die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer diskutieren.
Faulenzer?
Das Faulenzer-Narrativ sitzt uns tief in den Knochen. Sogar in Zeiten von Rekordbeschäftigung meint die Regierung, sie müsse nach dem Phantom des Totalverweigerers jagen. In einem Vortrag zum BGE weist zwar ein Professor für Christliche Sozialethik auf eine Studie aus Finnland hin, die keinerlei Anzeichen fand, dass das BGE zu weniger Arbeit führe, im Gegenteil. Trotzdem wiederholte er ohne Belege die Ansicht, mit BGE würden die Menschen die Arbeitszeit reduzieren.
Dieses Vorurteil widerlegt die deutsche BGE-Studie erneut. Die finnische Studie war auf Empfänger von Arbeitslosengeld beschränkt. Bei der deutschen Studie dagegen arbeiteten die BGE-Empfänger, machten eine Ausbildung oder studierten. Sie hätten innerhalb von drei Jahren ihre Tätigkeit verlieren, reduzieren oder aufgeben können. Im Vergleich mit einer Kontrollgruppe war aber kein Nachlassen der Arbeitsleistung zu verzeichnen.
Die Ansicht, das Hängemattenphänomen sei einfach Teil der Lebenserfahrung, sollten wir also nicht unkritisch übernehmen. Wenn Menschen nicht arbeiten, kann das an körperlichen Beschwerden, Burn-Out, Depression oder Verpflichtungen in der Pflege liegen. Dennoch gerät man beim Bürgergeld in den Verdacht des Faulenzens und muss wiederholt die Berechtigung nachweisen. Das BGE gibt Menschen dagegen die Möglichkeit, drängende Probleme zu bearbeiten, ohne dass sie vom Amt gegängelt werden und wirtschaftlich untergehen. Die Studien in Deutschland und Finnland, aber auch in Kanada haben sogar nachgewiesen, dass das BGE die Gesundheit verbessert.
Christlich-theologische Argumente?
Aus meiner theologisch-ethischen Sicht klingt das sehr nach dem theologischen Begriff der Gnade: Gott erkennt den Menschen an, auch ohne Bedarfsprüfung und Leistungsnachweis. Als ich ein Radiointerview mit dem Initiator der neuen BGE-Studie, Michael Bohmeyer, hörte, dachte ich beinahe, ich höre den alten Kirchentagssound. Dabei hat Bohmeyer ganz unreligiös gesprochen. Das BGE signalisiert den Menschen: Du bist OK, du bist genug. Gemeinsam mit einer Journalistin schreibt er in einem Buch: "Existenzangst weicht einem Gefühl der Existenzberechtigung, bedingungslos."
Allerdings: Christlich-religiöse Ansichten sind an sich kein ausreichendes Argument für das BGE. Manche Christinnen und Christen meinen, dass man die Frömmigkeit im Privaten ausleben soll, aber dass das gesellschaftliche Miteinander eine ganz andere Sache ist. Und wenn BGE, dann müssten ja auch diejenigen zur Finanzierung beitragen, die bestimmte christliche Überzeugungen nicht teilen. Trotzdem könnte es sein, dass ein alter jüdisch-christlicher Gedanke in eine politische Richtung weist, die einfach Sinn ergibt, politisch, wirtschaftlich und sozial, ob man nun religiös ist oder nicht!
Wozu jetzt das BGE?
Für viele klingt das BGE skandalös großzügig, ja naiv. Doch die Zahlung hat klare soziale Ziele: Denjenigen mit kleinen Einkommen soll das BGE bessere gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen. Die Bedingungslosigkeit bedeutet gerade bei geringfügigen Einkommen Verlässlichkeit in der Finanzplanung. Beim Bürgergeld hängt dagegen die Drohung von Kürzungen wie ein Damoklesschwert über den Menschen. Das BGE soll zugleich die soziale Schere etwas schließen und ökonomische Ungleichheit teils korrigieren. Außerdem speist sich die Gefährdung der Demokratie durch die Rechtspopulisten aus der Wahrnehmung, dass viele Menschen gesellschaftlich abgehängt werden.
Besonders attraktiv finde ich am BGE zwei Ziele. Einmal federt die Bedingungslosigkeit mittelfristige Härten ab. Ein Arbeiter mit Bandscheibenvorfall kann sich auf die Genesung konzentrieren. Wer ungeplant schwanger wird, sich mit dem Lebenspartner überwirft oder in der Pflege der Eltern einspringen muss, hat mehr Sicherheit. Für solche Fälle bietet unser Sozialsystem zwar Regelungen und Hilfen. Aber die sind bürokratisch, befristet und funktionieren verschiedentlich nicht. Und die markigen Ansagen aus der neuen Regierung zeigen: Wer Hilfe braucht, gerät schnell in den Verdacht, sich Sozialleistungen zu erschleichen.
Innovativ und wichtig finde ich ein zweites Ziel. Das BGE kann helfen, Arbeitende aus dem Lock-In zu befreien, sowohl individuell als auch gesamtgesellschaftlich. Individuell sind viele Menschen in eine prekäre berufliche Tätigkeit eingesperrt. Sie arbeiten im Callcenter, im Schlachthaus oder tragen Pakete aus. Sie sind gestresst, verlangen ihrem Körper viel ab, werden beschimpft und verdienen sehr wenig. Einige arbeiten zwei Jobs, haben Schulden oder sind trotz Arbeit aufs Bürgergeld angewiesen. Sie haben kaum eine Chance, etwas Neues auszuprobieren, Talente zu entdecken und auf eine Tätigkeit umzuschwenken, die ihnen sinnvoller erscheint. Beim Bürgergeld sind sie meist auf den bisherigen Weg festgelegt.
Wie das BGE den Lock-In-Effekt des Prekariats überwinden kann, zeigt etwa die genannte Dokumentation. Das oben genannte theologische oder humanistische Argument wird konkret, wenn dort eine BGE-Empfängerin sagt: Mit der beruflichen Neuorientierung weg vom Callcenter hat ihr das BGE die "Würde zurückgegeben".
Aber auch gesamtgesellschaftlich droht ein Lock-In. Mit der künstlichen Intelligenz kommt ein neuer Strukturwandel auf unsere Berufswelt zu. In den großen amerikanischen Digitalunternehmen hat die KI eine ungeheure Wucht angenommen, aber selbst internationale politische Spitzentreffen zum Thema KI, etwa in Großbritannien und Frankreich, werden in Deutschland relativ wenig wahrgenommen. Der Bedarf an menschlichen Arbeitskräften wird sinken, zum Beispiel in den Bereichen Sachbearbeitung, Buchhaltung, Verwaltung und Autorentätigkeit, in den USA sogar bereits in der Rechtsprechung. In der Industrie unterstützt die KI außerdem einen neuen Automatisierungsschub.
Industrielle Revolution und Digitale Revolution
Es ist also Kreativität gefragt bei der Entwicklung neuer Tätigkeiten und Verdienstmöglichkeiten. Einen solchen Strukturwandel kann die Politik aber nicht weitgehend von oben steuern. Sie ist darauf angewiesen, dass Initiativen in Forschung und Zivilgesellschaft neue Modelle der Erwerbstätigkeit entwickeln. Aber auch Bürgerinnen und Bürger müssen teils selbst die Initiative ergreifen und sich neue Wege bahnen. Aber dazu brauchen die Individuen Freiräume, die das bisherige Sozialsystem nicht bereithält. Hier ermöglicht das BGE Fortbildungen und Umschulungen. Ohne komplizierte Prüfverfahren hält es Ressourcen bereit, auch dann, wenn sich Menschen zum Beispiel beruflich selbständig machen wollen.
Unsere Sozialsysteme stammen im Grundansatz aus der Industriellen Revolution, aus dem 19. Jahrhundert. Nun aber will man der Herausforderung des Wandels begegnen, indem man das lebenslange Lernen betont. Die digitale Revolution des 21. Jahrhunderts werden wir also nicht bestreiten mit einem Sozialsystem, das im wesentlichen aus der Industriellen Revolution des 19. Jahrhunderts stammt.
Ausblick
Eine weitere kritische Frage wird oft an das BGE gerichtet: Was ist mit den Jobs, die keiner machen will? Wer das BGE erhält, gibt vielleicht die Tätigkeit als Putzfrau oder Pflegekraft auf – aber wer wird diese Rollen dann übernehmen? Das ist ein gutes Argument, aber nicht, weil es einen guten Einwand gegen das BGE macht, sondern weil es die harten Bedingungen unseres Wirtschaftssystems aufzeigt. Schlecht bezahlte Tätigkeiten, die als unattraktiv gelten, werden von Menschen aus bildungsfernen Schichten übernommen. Sie haben keine andere Wahl und tun das nicht zeitweise zur Überbrückung, sondern oft dauerhaft, mit dem Resultat der Altersarmut. Zwar ist es um die soziale Mobilität in Deutschland nicht gut bestellt, aber dass unser jetziges Wirtschaftssystem Menschen in die ungeliebten Nischen nötigt, wird nicht kritisch hinterfragt. Am BGE wird sogar kritisiert, dass es Menschen nicht erbarmungslos nötigt, sondern ihnen einen Ausweg aus einer Zwangslage ermöglicht.
Man sollte also nicht das Putzfrauenargument gegen das BGE ausspielen. Beide Parteien: wer das BGE befürwortet und wer es ablehnt, müssen sich fragen, wie wir die ungeliebten, aber "systemrelevanten" Berufe attraktiver gestalten. In der Zwischenzeit können Sie sich zum Beispiel schon jetzt selbst um ein BGE bewerben, dem Verein "Mein Grundeinkommen" beitreten oder dort für die Auszahlung von Grundeinkommen spenden!