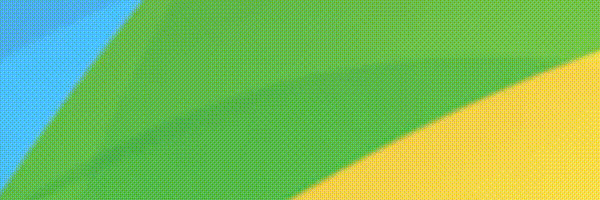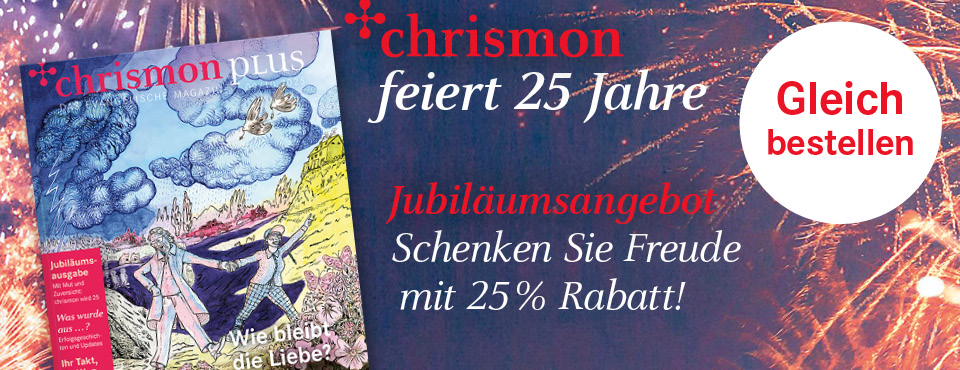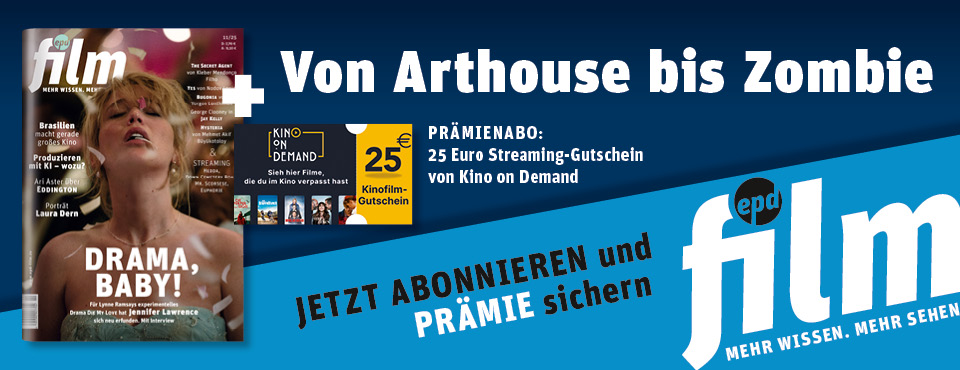Dass auch achtzig Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs an die Verbrechen der Nationalsozialisten erinnert werden muss, steht außer Frage. Gerade angesichts der aktuellen politischen Entwicklung sind Filme wie zuletzt "Führer und Verführer" (2024) von Joachim A. Lang umso bedeutsamer: weil sie analysieren, warum Adolf Hitler vergleichsweise leichtes Spiel hatte, die Massen für seine Sache zu begeistern.
Ein wichtiges Element der nahezu perfekten Propagandamaschinerie von Joseph Goebbels war die Arbeit Leni Riefenstahls. Im Alltag hatten die Gleichschaltung der Presse und spätestens mit Beginn des Zweiten Weltkriegs auch die Wochenschauen im Kino den größeren Einfluss, aber mit ihrem Reichsparteitagsfilm "Triumph des Willens" (1934) und dem zweiteiligen Dokumentarfilm über die Olympischen Spiele 1936 in Berlin setzte die Regisseurin Maßstäbe, die bis heute die indoktrinierende Berichterstattung der Staatsmedien in Russland und China prägen; und das keineswegs nur im Sport.
Tilmann P. Gangloff, Diplom-Journalist und regelmäßiges Mitglied der Jury für den Grimme-Preis, schreibt freiberuflich unter anderem für das Portal evangelisch.de täglich TV-Tipps und setzt sich auch für "epd medien" mit dem Fernsehen auseinander. Auszeichnung: 2023 Bert-Donnepp-Preis - Deutscher Preis für Medienpublizistik (des Vereins der Freunde des Adolf-Grimme-Preises).
Nach dem Krieg wurde die Regisseurin als Mitläuferin eingestuft, weil sie es in den Vernehmungen geschickt verstanden hatte, sich als reine Auftragnehmerin darzustellen, deren Interesse stets nur der Kunst gegolten habe. Diese Haltung sollte sich als die Rolle ihres restlichen Lebens erweisen, wie Andres Veiel in seinem Film "Riefenstahl" mit Hilfe vieler Interviewausschnitte vorführt: Immer wieder wird sie auf dieses Thema angesprochen, immer wieder weicht sie aus oder bestreitet die Vorwürfe.
Das tat sie auch in einem Gespräch, das Sandra Maischberger im Sommer 2002 mit ihr führte; damals ist Riefenstahl hundert geworden. Anschließend war die TV-Moderatorin derart unzufrieden, dass sie beschloss, einen Dokumentarfilm über die Regisseurin zu produzieren; und dann gingen die Jahre ins Land.
Bewegung kam in das Projekt, als die Erben den Nachlass Riefenstahls (sie ist 2003 gestorben) 2016 der Stiftung Preußischer Kulturbesitz übergaben und Maischberger die Erlaubnis bekam, das aus 700 Kisten bestehende Material zu erschließen. Damit stand dem für Filme wie "Black Box BRD" (2001), "Wer wenn nicht wir" (2011) oder "Beuys" (2017) mit allen wichtigen Filmpreisen ausgezeichneten Veiel ein riesiger Fundus privater Filmaufnahmen, Fotos und Tondokumente zur Verfügung, darunter auch viele aufgezeichnete Telefonate.
Wie in allen solchen Fällen war wohl die größte Herausforderung, diesem Wust einen roten Faden abzutrotzen, und tatsächlich liegt hier eine Schwäche des Films: Das Sammelsurium wirkt auch durch die vielen Zeitsprünge mitunter etwas unstrukturiert und erlaubt sich zudem Exkurse, die wenig zur Wahrheitsfindung beitragen, darunter die späte Beziehung der einstigen Regisseurin zum vierzig Jahre jüngeren Lebensgefährten.
Natürlich referiert Veiel auch die Karriere Riefenstahls, die als Schauspielerin dank diverser Bergfilme bereits ein Topstar war, als sie selbst die Regie übernahm. In der zweiten Hälfte konzentriert er sich jedoch auf den Rechtfertigungsmodus. Schlüsselszene ist ein Auftritt in der WDR-Talkshow "Je später der Abend" im Jahr 1976.
Wie so oft wird die Frau, deren kometenhafter Aufstieg mit der Befreiung Deutschlands vom Faschismus ein jähes Ende fand, in die Defensive gedrängt. Anschließend spielt der Film eine Vielzahl telefonischer Gespräche mit Gesinnungsgenossen ein. Spätestens jetzt wird deutlich, wes’ Geistes Kind Riefenstahl wirklich war. Ähnlich aufschlussreich sind Abschnitte aus den Entwürfen ihrer Memoiren. Hier beschreibt sie unter anderem frühe und zum Teil exzessive Gewalterfahrungen durch den Vater. Diese Passagen lassen erahnen, warum sie den Ehrgeiz hatte, sich in Männerwelten durchzusetzen und bei Dreharbeiten oft in äußerst gefährliche Situationen zu begeben; ein Leben am Limit, würde man heute sagen.
Anders als vergleichbare Produktionen kommt "Riefenstahl" ohne die Einschätzungen von Weggefährten oder Sachverständigen aus. Stattdessen konstruiert Veiel eine Art Gesprächsfiktion: hier die öffentlichen Auftritte, dort konträre Fundstücke aus dem Nachlass, ergänzt durch unveröffentlichte Ausschnitte aus Interviews, in denen Riefenstahl mitunter komplett die Contenance verliert, wenn ihr die Fragen nicht passen.
Ungewöhnlich für Veiel ist auch der von Ulrich Noethen eingesprochene Off-Text: Einige offenkundige Lügen konnten einfach nicht unkommentiert stehen bleiben. Dass Riefenstahl von dem Mann, den sie später in ihren Briefen mit "Mein verehrter Führer" anspricht, bis 1932 noch nie etwas gehört haben wollte, ist in der Tat kaum zu glauben.