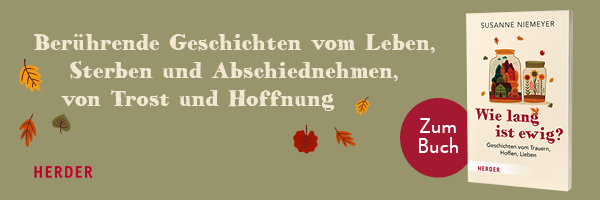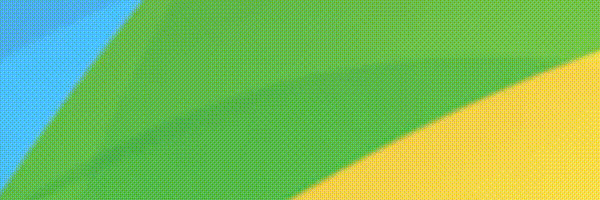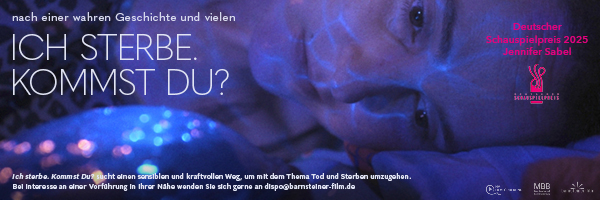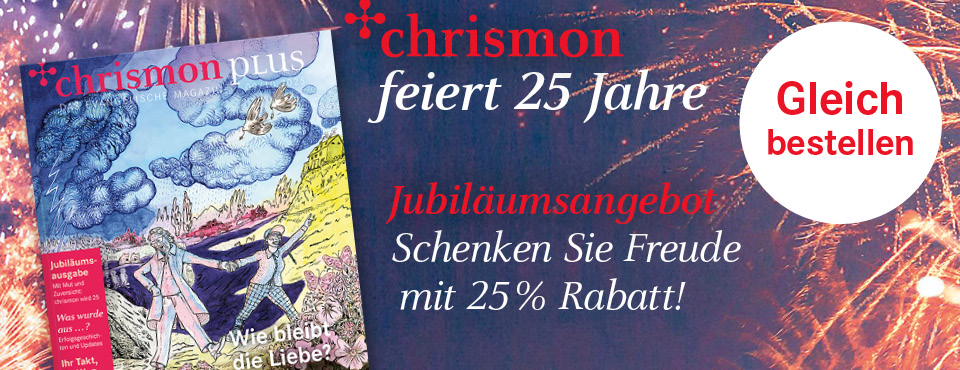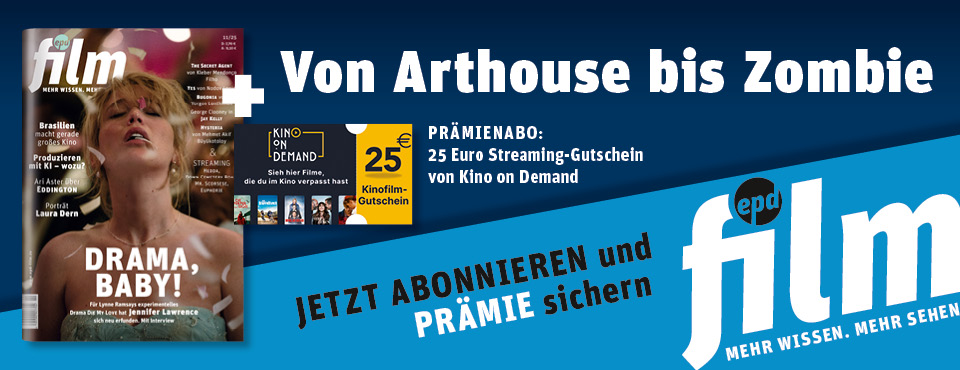Am Beginn des Streits über Frieden stand ein Nein. "Ich sage Nein", sagte der Friedensbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Friedrich Kramer, vor drei Jahren zu Waffenlieferungen an die von Russland überfallene Ukraine. In der evangelischen Kirche vertrat er eine Minderheitenposition. Viele Bischöfinnen und Bischöfe äußerten eher Verständnis für die militärische Unterstützung des Landes. Eine Diskussion entflammte, an deren Ende nun eine neue friedensethische Position steht, die am Montag in Dresden präsentiert wurde. Kramers "Nein" hat sich nicht durchgesetzt.
Vorgestellt wurde die Denkschrift in der Dresdner Frauenkirche, zerstört bei einem alliierten Bombenangriff 1945, nach dem Fall der Mauer wiederaufgebaut. Sie sei ein Symbol dafür, wie zerstörerisch Krieg sei, sagte die EKD-Ratsvorsitzende Kirsten Fehrs. Sie ist auch ein Symbol für das Dilemma, über das die evangelische Kirche diskutiert: Die Bombenangriffe auf Dresden waren Teil der Befreiung Deutschlands vom Nationalsozialismus. Die vielen zivilen Opfer dieser Bombardements sind zugleich bis heute ein Trauma in der sächsischen Landeshauptstadt.
Die Frage, wann der Einsatz militärischer Gewalt gerechtfertigt ist, war zentral für das Redaktionsteam der Denkschrift, die nach Konsultationen und Diskussionen von Theologen, Wissenschaftlern und Friedensaktivisten eine neue Position der EKD formulieren sollte. Die lautet so: Es gibt einen Vorrang für den Schutz vor Gewalt, der als letztes Mittel auch den Einsatz militärischer Mittel rechtfertigt. Ein Staat könne und dürfe diese Instrumente zur Verfügung haben, um seine Bevölkerung zu schützen und den Rechtsstaat zu wahren, brachte es Fehrs auf den Punkt.
Gleichzeitig dürften zivile Mittel der Konfliktlösung und Friedensbildung nicht aus dem Blick geraten. "Deutschland muss friedenstüchtig sein bei allen notwendigen Anstrengungen der Verteidigungsfähigkeit", sagte die Hamburger Bischöfin. Ein Dilemma bleibe dabei Jesu Gebot des Gewaltverzichts, ergänzte sie. Es binde Christen, gerate aber auch in Spannung mit dem Gebot der Nächstenliebe, wenn Menschen nicht geschützt würden.
Die EKD hatte zuletzt 2007 eine Friedensdenkschrift veröffentlicht, die den Schutz vor Gewalt gleichrangig neben anderen Kriterien, etwa dem Abbau von Ungleichheit, als Voraussetzung für Frieden definierte. Vom Vorrang für den Schutz der Gewalt leiten sich in der neuen Denkschrift weitere Akzentverschiebungen ab, die als Rechtfertigung einer Politik der militärischen Abschreckung gelesen werden können. Das gilt etwa für den Wehrdienst, wo die EKD eine Pflicht nicht komplett ablehnt, oder eine Aufweichung des Neins zu Atomwaffen, weil es politische Risiken birgt.
Innerkirchliche Kritik
Die neue Denkschrift sei "in einer anderen Welt entstanden", sagte Friederike Krippner, Akademiedirektorin und Leiterin des Redaktionsteams. Nicht allen in der Kirche gefällt diese Form einer Real-Ethik. Die Arbeitsgemeinschaft Dienst für den Frieden kritisierte, die Denkschrift fokussiere darauf, "militärisches Handeln friedensethisch zu rehabilitieren".
Auch der Friedensbeauftragte Kramer habe teilweise "geschluckt", wie er es selbst formulierte, insbesondere bei der Position zu Atomwaffen. "Ich bin der Meinung, wir sollten bei einem klaren Nein ohne jedes Ja bleiben", sagte der Bischof, lobte zugleich aber auch den Diskussionsprozess und die Kompromissbereitschaft bei der Entstehung der Schrift. Die Position des radikalen Gegenpols, die einige von ihm erwartet hatten, nahm er bei der gemeinsamen Präsentation des Grundsatzpapiers jedenfalls nicht ein.
Das übernahm eher einer Regionalbischöfin aus Kramers mitteldeutscher Landeskirche, Friederike Spengler. Bei der aktuell in Dresden tagenden EKD-Synode sagte sie, es tue ihr weh, welch kleine Stellung dem Pazifismus in der Schrift zugestanden werde. Als Gegenrednerin meldete sich im Kirchenparlament die FDP-Politikerin Linda Teuteberg. Es stehe auch der evangelischen Kirche und der Friedensbewegung gut zu Gesicht, Fehler einzugestehen. Wer vor der Bedrohung durch Russland gewarnt habe, sei früher auch dort als "Kriegstreiber" bezeichnet worden. In der Denkschrift sieht sie ein Zeichen, dass die Kirche "sicherheits- und außenpolitisch erwachsen" werde.