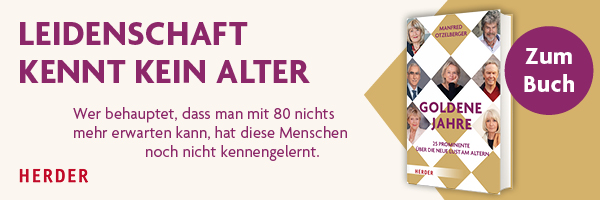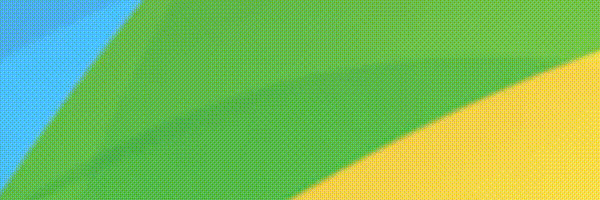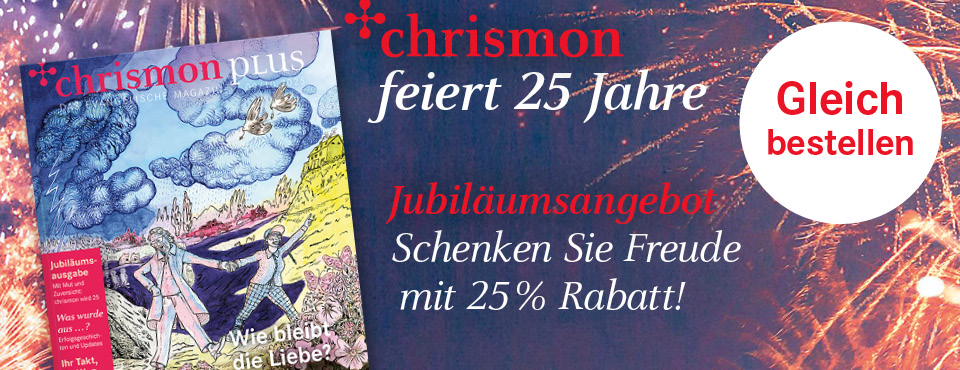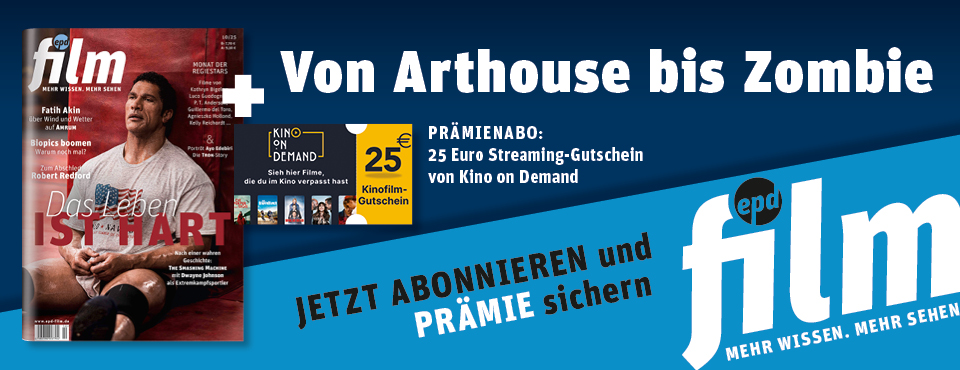Nach monatelangem Gezerre in der Koalition hat das Bundesarbeitsministerium den Gesetzentwurf zur Bürgergeldreform ausformuliert. Angestrebt wird ein Kabinettsbeschluss vor Jahresende, wie am Freitag aus Ministeriumskreisen in Berlin verlautete. Hier ein Überblick über die zentralen Punkte der künftigen Grundsicherung:
SANKTIONEN:
Leistungskürzungen wegen mangelnder Kooperation betreffen derzeit weniger als ein Prozent der Bürgergeldbeziehenden. Dennoch standen sie in den vergangenen Monaten oft im Fokus der politischen Debatte. Bisher beginnen die Sanktionen bei einer Kürzung des Regelsatzes um zehn Prozent und enden bei dessen Streichung. Miet- und Heizkosten werden stets weiter bezahlt. Künftig wird Menschen, die ein Jobangebot ablehnen, der Regelsatz für einen Monat gestrichen. Die Miete wird direkt an den Vermieter überwiesen. Wer eine andere Pflichtverletzung begeht, etwa keine Bewerbungen schreibt oder eine Fördermaßnahme abbricht, bekommt drei Monate lang nur 70 Prozent des Regelsatzes.
Härter können die Sanktionen ausfallen, wenn jemand Termine beim Jobcenter versäumt. Nach dem zweiten grundlosen Terminversäumnis ist eine Kürzung des Regelsatzes um 30 Prozent vorgesehen. Bei drei versäumten Terminen hintereinander wird der Regelsatz komplett gestrichen und die Miete ebenfalls direkt an den Vermieter überwiesen. Wird ein weiterer Termin versäumt, gibt es gar kein Geld mehr, auch nicht für Wohn- und Heizkosten. Es soll aber Schutzvorkehrungen geben, damit "es nicht die Falschen trifft", wie es aus dem Ministerium hieß. Zum Beispiel ist vorgesehen, die Wohnkosten weiterzuzahlen, wenn andere Menschen mit den Betroffenen zusammenleben, etwa Kinder.
WOHNKOSTEN:
Bisher wird erst nach einem Jahr geprüft, ob die Miete als angemessen eingestuft und somit komplett vom Staat bezahlt wird. Jede Kommune legt eigene Grenzwerte für die Angemessenheit fest. In der Regel ist das eine bestimmte Summe pro Haushaltsmitglied. Künftig soll im ersten Jahr das Anderthalbfache dieser kommunalen Werte akzeptiert werden, mehr aber nicht. Für die Zeit danach gilt wie bisher, dass Menschen, deren Miete als überhöht eingestuft wird, zur Kostensenkung aufgefordert werden. Klappt das nicht, müssen sie einen Teil der Miete aus eigener Tasche zahlen. Für die Höhe der Heizkosten gibt es schon heute keine Karenzzeit.
Künftig sollen die Kommunen zusätzlich zu den Pro-Kopf-Werten auch maximale Mietpreise pro Quadratmeter festlegen. So soll "Mietwucher in Form von überteuerten Kleinstwohnungen" verhindert werden. Neu ist zudem, dass die Miete in Gebieten mit Mietpreisbremse dieser Vorgabe entsprechen muss und sonst als zu hoch gilt. Die Grundsicherungsbeziehenden müssen sich dann an den Vermieter wenden und eine Senkung fordern. Geht der Eigentümer nicht darauf ein, übernimmt das Jobcenter die weitere Auseinandersetzung bis hin zur Klage gegen den Vermieter.
SCHONVERMÖGEN:
Bevor jemand Bürgergeld bekommt, muss er in einem gewissen Rahmen sein Vermögen aufbrauchen. Derzeit gilt dies im ersten Jahr des Bezugs für Vermögen über 40.000 Euro für die Leistungsbeziehenden und 15.000 Euro für jeden weiteren Menschen in der Bedarfsgemeinschaft. Später sind es einheitlich 15.000 Euro. Die Karenzzeit soll nun wegfallen und die Höhe des Schonvermögens "an das Lebensalter anknüpfen". Vorgesehen sind vor dem 20. Geburtstag 5.000 Euro. Von 20 bis 39 Jahren sind es 10.000 Euro, von 40 bis 49 Jahren sind es 12.500 und ab 50 dann 15.000 Euro.
WEITERE REGELUNGEN:
Wie im früheren Hartz-IV-System soll Vermittlung in Arbeit in der Regel Vorrang vor einer Ausbildung oder Qualifizierung haben. Um die Jobchancen von Landzeitarbeitslosen zu verbessern, soll es einen breiteren Anspruch auf ein staatlich gefördertes Arbeitsverhältnis geben. Auch die Förderung junger Menschen ohne Berufsabschluss soll verbessert werden. Arbeitslose Eltern sollen bereits dann vom Jobcenter betreut werden, wenn ihr Kind ein Jahr alt ist. Bisher gilt eine Grenze von drei Jahren. Sofern die Kinderbetreuung gesichert ist, gilt es dann als zumutbar, dass die Mütter und Väter eine Arbeit annehmen oder zum Beispiel einen Deutschkurs besuchen.