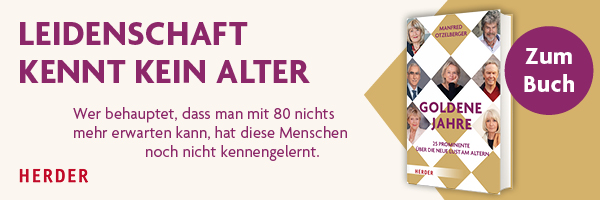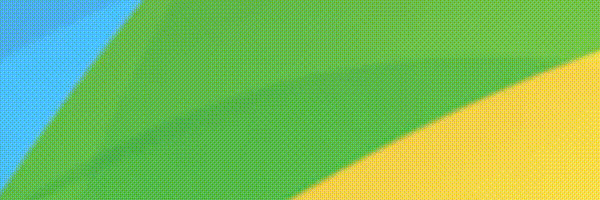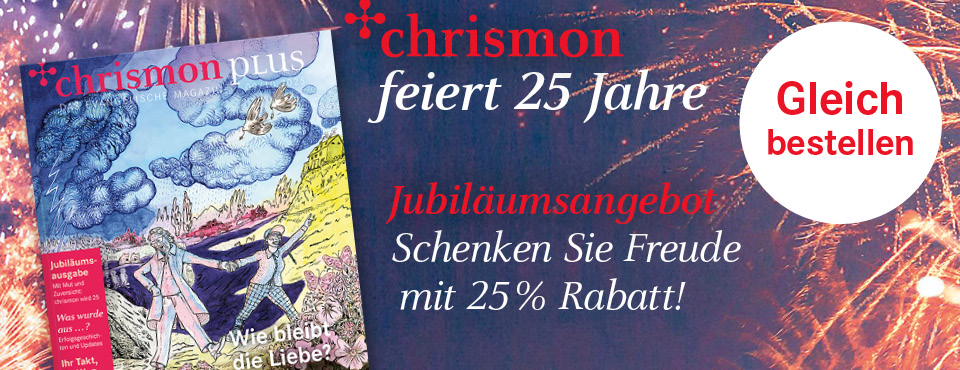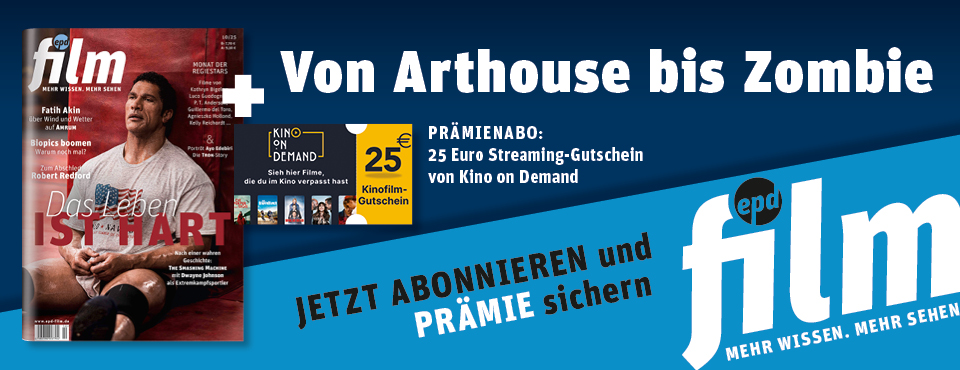Jeder Mensch, dem Unrecht widerfahren ist, hat das Verlangen nach Gerechtigkeit; so weit die Theorie. In der Praxis ist Gerechtigkeit jedoch keine juristische, sondern eine moralische Größe; deshalb entspricht die Rechtsprechung oftmals nicht dem Gerechtigkeitsempfinden der Betroffenen. Der französische Moralist Joseph Joubert hat Gerechtigkeit einst als "das Recht der Schwächeren" definiert. Vor Gericht gilt jedoch nicht selten das Recht des Stärkeren, weil er zum Beispiel die besseren Anwälte hat. Deshalb, und darum geht es in diesem "Wien-Krimi", werden Männer, die ihre Frauen misshandeln, nach Ansicht der Betroffenen nicht streng genug bestraft.
Gegen Ende des Films formuliert eine Betroffene diese Ohnmacht, als sie mit einer Mischung aus Verbitterung, Zorn und Resignation berichtet, wie viele gezielte Frauenmorde es im letzten Jahr allein in Wien gegeben habe und dass bereits jede dritte Österreicherin häusliche Gewalt erlebt habe. In dieser Szene kulminiert die Botschaft des Drehbuchs, aber natürlich ist schon lange vorher klar geworden, was Uli Brée mit seiner ersten Arbeit für die Reihe vermitteln will, zumal Jouberts Sinnspruch gleich mehrfach wiederholt wird.
Wie so oft in solchen Fällen tut es dem Krimi nicht gut, dass die Mission den Verantwortlichen wichtiger zu sein schien als der Anspruch, in erster Linie eine fesselnde Geschichte zu erzählen und den moralischen Aspekt geschickt zu verpacken. Dabei ist der Handlungsentwurf durchaus gelungen: Vor zehn Jahren haben Alex Haller (Philipp Hochmair) und seine damalige Kripo-Partnerin Grischka Tanner (Ursula Strauss) einen Einbrecher in flagranti ertappt.
Tilmann P. Gangloff, Diplom-Journalist und regelmäßiges Mitglied der Jury für den Grimme-Preis, schreibt freiberuflich unter anderem für das Portal evangelisch.de täglich TV-Tipps und setzt sich auch für "epd medien" mit dem Fernsehen auseinander. Auszeichnung: 2023 Bert-Donnepp-Preis - Deutscher Preis für Medienpublizistik (des Vereins der Freunde des Adolf-Grimme-Preises).
Der Mann hat soeben eine alte Frau getötet, Grischka verfolgt ihn aufs Dach, er kommt ins Straucheln und kann sich gerade noch an der Dachrinne festhalten, aber sie rührt keinen Finger, um ihn zu retten. Aufgrund von Hallers Aussage muss sie für fünf Jahre ins Gefängnis. Schon allein die Idee dieses Ausflugs in die Vergangenheit ist interessant. Die Verknüpfung mit der Gegenwart ergibt sich durch eine doppelte Entführung: Nach einem Abend im Club steigt Haller in ein Taxi, hört aus dem Kofferraum Klopfgeräusche, ist jedoch machtlos, weil die Fahrerin ihm eine Wasserflasche mit Barbituraten gegeben hat. Mit letzter Kraft kann er sich aus dem Wagen retten.
Am nächsten Tag wird die Person aus dem Kofferraum tot aufgefunden. Es handelt sich um einen Mann, der seine Familie misshandelt hat, aber mit einer viel zu milden Strafe davongekommen ist; und alle Spuren führen zu Grischka Tanner. Die frühere Polizistin ist heute Psychotherapeutin und kümmert sich um Frauen, die häusliche Gewalt erfahren haben. Als Drehbuch trug "Geister der Vergangenheit" den Titel "Freuds Fehler". Die damit verknüpfte Ebene ist weitaus eleganter erzählt als die Dialoge mit der Moralkeule. In der ansprechendsten Szene besucht Haller das Sigmund-Freud-Museum in der ehemaligen Praxis des Begründers der Psychoanalyse und trifft dort auf Anna Bernays (Dennenesch Zoudé).
Die Freudianerin erkennt umgehend, dass dieser Teilnehmer ihrer Führung genauso blicklos ist wie sie selbst. Da man jedoch, wie alle Welt dank "Der kleine Prinz" weiß, nur mit dem Herzen gut sieht, weil das Wesentliche für die Augen unsichtbar ist, verstehen sich die beiden blind und kommen sich im Umweg über Freud näher. Dessen größter Fehler, erfährt Haller, sei es gewesen, die Frauen zu unterschätzen.
Die Teilnehmerinnen von Grischkas Therapiegruppe bekräftigen denn auch mehrfach, sie wollten keine Opfer mehr sein; ein Vorsatz, den ihre Darstellerinnen mitunter konterkarieren. Ohnehin ist der Film viel stärker, wenn Regisseurin Mimi Kezele auf die Kraft der Bilder vertraut. Während es wenig überzeugend wirkt, wie ein Mann seine Frau beim Besuch im Präsidium ’runtermacht, kommt es unmittelbar drauf zu einem bestürzenden Moment, als er ihr vor den blinden Augen Hallers ohne jede Vorwarnung im Auto Gewalt antut.
Ähnlich wirkungsvoll ist eine Szene gegen Ende: Die Frau steht in der Küche, der Mann ruft "Schatz!", sie dreht sich um und weicht zurück; dann wird das Bild schwarz. Viel öfter wird jedoch in Worte gefasst, was Anlass zur Empörung gibt; zum Beispiel, dass die Kosten für eine Therapie nur dann übernommen werden, wenn die Gewalttäter auch verurteilt worden sind. Gleich mehrfach muss Haller außerdem betonen, dass Selbstjustiz keine Lösung sei. Die Bildgestaltung (Felix von Muralt) ist allerdings sehr sorgfältig und das Finale mit einem Zweikampf am Rande eines gähnenden Abgrunds ziemlich spannend.