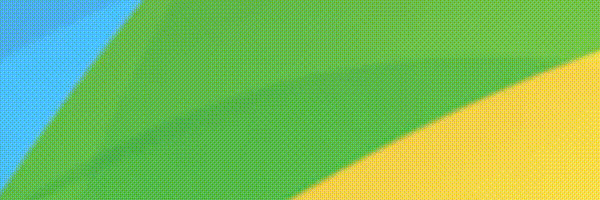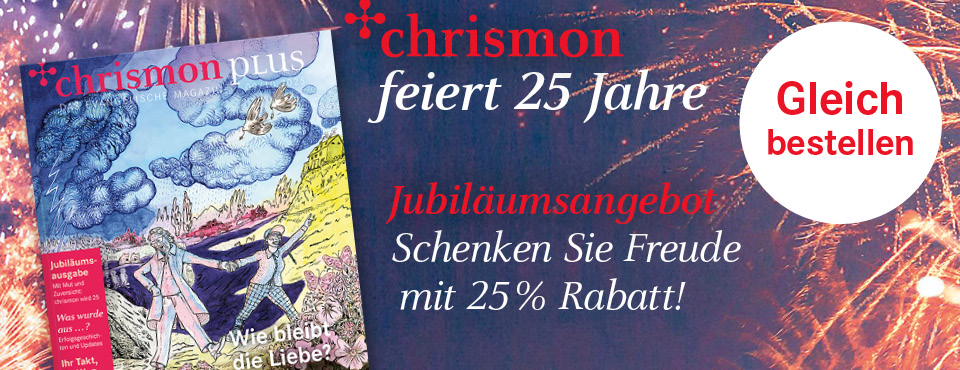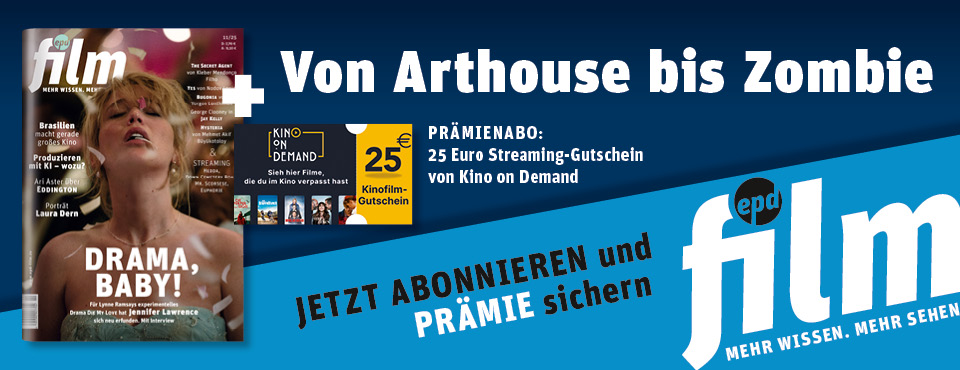epd: Gilt die vor 500 Jahren gefeierte Deutsche Messe als der erste evangelische Gottesdienst?
Alexander Deeg: Nein, auch vor 1525 wurden in den Städten der Reformation evangelische Gottesdienste gefeiert - allerdings mit lateinischer Liturgie und deutscher Predigt. In Städten wie Basel oder Pforzheim gab es auch schon ganze Gottesdienste auf Deutsch. Der durch den Bauernkrieg bekannte Thomas Müntzer führte in Allstedt eine deutsche Messe ein. In der Schweiz prägte Huldrich Zwingli die Gottesdienstform, während in Reutlingen, Straßburg und Nürnberg weitere Reformatoren aktiv waren. Überall entstanden so Gottesdienste in deutscher Sprache, wobei Luther selbst anfangs sehr zurückhaltend agierte.
Warum?
Deeg: Als der Reformator Karlstadt Ende 1521 und Anfang 1522 in Wittenberg einen deutschen Gottesdienst abhielt und Bilder aus den Kirchen entfernte, empfand Luther das als umstürzend und bedrohlich und kehrte von der Wartburg zurück. Mit seinen Invokavit-Predigten warnte er davor, die Reformen zu überstürzen. 1523 veröffentlichte er eine reformierte lateinische Messe, in der er den traditionellen Ablauf beibehielt, aber die mittelalterliche Idee des Messopfers beseitigte und das Abendmahl veränderte.
Was geschah danach?
Deeg: Viele, unter anderem auch Johann der Beständige, der Kurfürst von Sachsen, übten Druck auf Luther aus und erbaten eine Deutsche Messe von ihm. Es waren zwei Dinge, die für Luther entscheidend waren. Er fand, man kann nicht einfach nur den Text auf Deutsch übersetzen und ansonsten so singen wie in der katholischen Messe. Das wäre nur ein Nachahmen, wie es die Affen tun, sagte er 1524 mal böse.
Das zweite war, dass viele Leute nicht verstehen, was da passiert, wenn der Gottesdienst auf Latein gefeiert wird. Es war Luthers Idee, dass diese in die Lage versetzt werden, wirklich mitzufeiern. Im Oktober 1525 arbeitete er dann drei Wochen lang mit zwei Hofmusikern von Johann dem Beständigen sehr intensiv in Wittenberg zusammen. Musik bildete den Kern seiner Arbeit. Für die Leute damals muss das Ergebnis ein besonderes Klangereignis gewesen sein.
Uraufführung, wenn man so sagen darf, war also am 29. Oktober 1525?
Deeg: Hier gibt es tatsächlich eine Schwierigkeit. In Wittenberg galt in dieser Zeit noch der julianische Kalender, es war nach heutiger Umrechnung einige Tage später als der 29. Oktober. Korrekter wäre es, das liturgische Datum zu nennen: Am 20. Sonntag nach Trinitatis 1525 wurde in Wittenberg zum ersten Mal Luthers Deutsche Messe gefeiert. Um die Jahreswende 1525/26 erschien die Deutsche Messe dann auch im Druck.
Was waren die Hauptziele von Luthers Deutscher Messe?
Deeg: Im Vorwort zur Deutschen Messe schreibt Luther sehr klar, dass er damit kein Gesetz vorlegen will. Damit widerspricht er vielen seiner Anhänger, die etwas Normatives von ihm wollten. Dazu war er nicht bereit. Aber was Luther angeregt hat, hatte große Bedeutung. Das sind etwa die Gemeindelieder, die herausgehobene Stellung der Predigt, die Gestalt der Einsetzungsworte zum Abendmahl und die Integration deutscher Lieder. Das alles war wirklich sehr bedeutend.
"In diesem Jahr kann auf 500 Jahre aaronitischer Schlusssegen im evangelischen Gottesdienst zurückgeblickt werden"
Was daraus prägt heutige evangelische Gottesdienste besonders?
Deeg: Luther schlug in seiner Deutschen Messe vor, den sogenannten aaronitischen Segen aus dem vierten Buch Mose als Schlusssegen zu verwenden: "Der HERR segne dich und behüte dich; der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden." Zuvor war im Gottesdienst meist der trinitarische Segen gebräuchlich - etwa: "Es segne dich Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist." Daher kann in diesem Jahr auch auf 500 Jahre aaronitischer Schlusssegen im evangelischen Gottesdienst zurückgeblickt werden.
War Luthers Gottesdienstgestaltung ein radikaler Bruch mit der römischen Tradition?
Deeg: Luther vollzieht keinen völligen Neustart, sondern setzt eigene Akzente innerhalb einer bestehenden kirchlichen Tradition. Er versteht den evangelischen Gottesdienst als bewusste Fortsetzung und Weiterentwicklung kirchlicher Formen und gestaltet diese auf evangelische Weise neu: mit stärkerer Beteiligung der Gemeinde, Veränderungen beim Abendmahl und einem besonderen Schwerpunkt auf Predigt und Verkündigung.
Wie reagierte die römisch-katholische Kirche auf Luthers Gottesdienstreform?
Deeg: Viele Entwicklungen, die mit den Wittenberger Reformen begannen, griff das Zweite Vatikanische Konzil (1962-65) rund 450 Jahre später für die katholische Kirche auf. Nach dem Konzil wurde die Messe vielerorts in der Landessprache gefeiert und die Eucharistie in beiderlei Gestalt - also mit Brot und Wein für alle Gläubigen - rückte stärker ins Zentrum, auch wenn das in der Praxis bis heute in der Regel nicht umgesetzt wird.
"Luther wollte das Abendmahl stärken"
Einige konservative Katholiken kritisierten diese Reformschritte und warfen der Kirche vor, Fehler der Reformation zu wiederholen. Zu den Neuerungen zählten auch die intensivere Beteiligung der Gemeinde und der direkte Blickkontakt zwischen Priester und Gottesdienstbesuchern - Veränderungen, die Luther bereits gefordert hatte.
In der evangelischen Kirche ist das Abendmahl seltener Teil des Gottesdienstes als in der katholischen Tradition. Hängt das mit dem Fokus der Deutschen Messe auf Verkündigung, Gemeindeliedern und der Trennung von Messe und Predigt zusammen?
Deeg: Luther wollte das Abendmahl stärken. Aber faktisch wissen wir aus Berichten aus Wittenberg aus der Mitte der Dreißigerjahre des 16. Jahrhunderts, dass relativ viele den Gottesdienst nach der Predigt verlassen haben. Ein ganz erstaunliches Phänomen. Mit dieser immensen Betonung auf die Predigt hatte das, was danach kam, für viele Gottesdienstbesucher weit weniger Bedeutung. Im Prinzip ein evangelisches Problem, das sich ja dann durch die Jahrhunderte gezogen hat.
Weiß man, wie lange damals gepredigt wurde?
Deeg: Wir wissen es nicht genau. Aber Mitschriften zufolge kann man schon sagen, dass eine Predigt durchaus eine knappe Stunde dauern konnte. Das kennen wir auch aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Predigten von einer Stunde waren damals die übliche evangelische Länge.
Hat Luthers starke Betonung von Wort und Musik der einzigartigen Kirchenmusik wie etwa von Bach den Weg bereitet?
Deeg: Das kann man durchaus so sagen. Joseph Ratzinger, der spätere Papst Benedikt XVI., hatte mal gesagt, worum er die Evangelischen beneide, sei zweifellos die Entwicklung der Kirchenmusik, die mit der Reformation ja auf eine Weise einsetzte, die wirklich sehr spezifisch war. Es ist eine Musik, die Wort und Musik so miteinander verbindet, dass das Wort noch mal ganz anders erlebbar wird. Die Sorgfalt, der hohe Qualitätsanspruch, den Luther im Blick auf die Musik hatte, ist eine Wegbereitung für alles, was danach kam.
Wird die Deutsche Messe heute noch irgendwo in der originalen Form gefeiert?
Deeg: Man könnte sagen, dass bei fast allen der rund 12.000 evangelischen Gottesdiensten in Deutschland sonntags eine "Deutsche Messe" gefeiert wird, wenn auch geprägt von 500 Jahren evangelischer Weiterentwicklung. Die genaue Form, wie sie Luther selbst vorschlug, wäre heute eine historische Rekonstruktion.