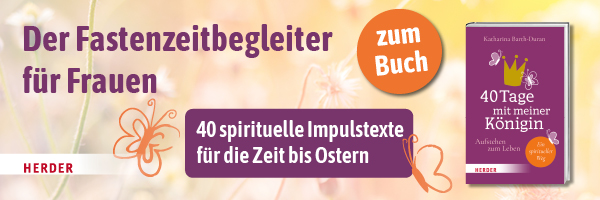Früher sah der Friedhof der lutherischen St. Clemens Kirche in Nebel bei weitem noch nicht so ansprechend aus wie heute. Viele der alten Grabsteine stapelten sich an der Begrenzung des Friedhofs hinter- und übereinander. Sie waren voller Erde, von Moosen und Algen belegt und zum Teil kaum noch lesbar. Dabei handelt es sich um einen einzigartigen kultur-historischen Schatz. Doch bis dieser ausgegraben wurde, sollte es bis 2010 dauern.
Franz-Bernd Reich besucht seit Jahrzehnten Amrum und kennt die Insel gut. Vor allem für die Kirche und den Friedhof interessiert sich der Düsseldorfer seit jeher und begrüßte es, als die Gemeinde schließlich realisierte, um was für einen sensationellen Fund es sich bei den alten Grabsteinen der St. Clemens Kirche in Nebel handelt - touristisch gesehen sowie historisch. Es geht auch um die Vorfahren von Menschen, die immer noch auf der Insel leben - also eine Art menschliche Insel-DNA.
Bei den 170 Steinen spricht man von redenden oder sprechenden Grabsteinen, denn es steht überraschend mehr darauf als nur das Geburts- und Sterbejahr. Franz-Bernd Reich erzählt: "Es stehen viele Geschichten auf den Steinen darüber, wie Männer und Frauen damals mit ihren Schicksalen und Schicksalsschlägen umgegangen sind." So kam es vor, dass Frauen, die in der Regel jung heirateten, zwei, drei Kinder bekamen – und nach dem dritten Kind im Kindbettfieber starben. "Da blieb dann ein 25-, 26-jähriger Mann mit drei kleinen Kindern zurück, der selbst zur See fahren oder irgendwas anderes tun musste, um Geld zu verdienen." Erstaunlicherweise habe ein solcher Mann in der Regel spätestens nach einem Jahr wieder eine Partnerin gefunden. Umgekehrt war es keine Seltenheit, dass eine junge Frau mit drei kleinen Kindern die Nachricht bekam, dass ihr Mann verunglückt sei. Auch die hatte in der Regel innerhalb eines Jahres einen neuen Partner.
Von solchen Geschichten kann man auf den Steinen teilweise lesen. Die Worte sind poetisch formuliert und kunstvoll oft in verschiedenen Schriftarten in die Steine graviert. Reich hat zu jedem einzelnen Stein die Familiengeschichten recherchiert und will sie in einem Buch herausgeben. Mit diesem Büchlein in der Hand würde der Friedhofsbesuch zu einer Entdeckungsreise voller Lebensgeschichten aus einer vergangenen Welt.
"Rauert Peters zum Beispiel, 1713 geboren, heiratete mit 22, bekam einen Sohn und verlor sowohl Sohn als auch Frau im Kindbettfieber noch im gleichen Jahr der Hochzeit", berichtet Reich. "Einige Jahre später heiratete er dann mit 28 noch einmal und hatte mehr Erfolg. Er bekam mit seiner Frau sechs Kinder und eine große Enkelschar. Er wurde ein wohlhabender Mann und war ein begehrter Patenonkel mit 16 Paten."
Auf einem anderen Grabstein ist eine ganze Kinderschar eingearbeitet, links die Buben, rechts die Mädels. "Er hat wirklich viel Geld aufgewendet, um sich der Nachwelt in Erinnerung zu bringen. Bis heute", so Reich. Dann die Familie Mechlenburg: sie stellte über 100 Jahre die Pastoren der Insel Amrum. "Damals wurden die Pastoren nicht pensioniert, sondern arbeiteten bis sie nicht mehr konnten", erzählt Reich. "Sie bekamen kein Gehalt, sondern ein Grundstück mit Landwirtschaft und mussten sehen, dass sie von dieser Landwirtschaft leben können."
Spannend ist auch der Grabstein von Hark Olufs. Er fuhr mit etwa zwölf Jahren zur See und kam mit 16 im Jahr 1810 in algerische Gefangenschaft, nachdem sein Schiff von algerischen Piraten gekapert wurde. "Er blieb zwölf Jahre in Gefangenschaft. In dieser Zeit arbeitete er sich zum engen Mitarbeiter des örtlichen Regionalfürsten hoch und nahm auch an militärischen Aktionen teil.", berichtet Reich. Letzten Endes sei er freigekommen und mit 28 Jahren auf die Insel zurückgekehrt. "Er wurde ein wohlhabender Mann und gründete eine Familie mit fünf Kindern. Mit nur 46 Jahren wurde er eines Tages von seiner Familie tot im Lehnsessel gefunden, als sie vom Gottesdienst zurückkehrte."
Mit 12 Jahren zur See, mit 20 erfahrener Seemann
Die Symbolik auf den Grabsteinen ist teilweise opulent. Es gibt Kreuz, Herz und Anker, - Glaube, Liebe, Hoffnung. Prächtige Bilder von Schiffen, die, richtig gedeutet, weitere Auskunft über das Leben der Begrabenen geben. So erzählt die Größe eines Schiffs, in welcher Art Seefahrt jemand unterwegs war. "Ein Einmaster war kein Boot, mit dem man um die Welt fahren konnte – das war eines, mit dem man hier kleinere Transporte oder Fischerei betrieben hat. Ein Zweimaster war ein Schiff, mit dem man über Nord- und Ostsee fahren konnte, für kleinere Transporte; sie reichten auch für die Walfahrt nach Grönland. Und die Dreimaster – das waren die Schiffe, mit denen man auf große Weltreisen gehen konnte: in die Karibik, bis in den Fernen Osten. "
Die Seefahrt war eine der Spezialitäten von Amrum. Man fuhr schon mit 12 oder 13 Jahren zur See und war mit 20 ein erfahrener Seemann. "Einige wurden Kapitäne und sind oft nach Holland, Norwegen oder Dänemark gegangen, weil von dort aus Schiffe auf große Fahrt gingen – zum Beispiel zum Walfang nach Grönland. Insofern waren viele Amrumer auch begehrte Kapitäne", sagt Reich.
Franz-Bernds Reichs Interesse an dem historischen Schatz wurde schon in seiner Schulzeit geweckt. "Ich wollte eigentlich wissen: Was waren das für Menschen, die unter den Steinen begraben sind?" Jahre später fiel ihm das Buch eines engagierten Insel-Historikers in die Hände. Dort fanden sich alle Inschriften veröffentlicht, sodass die unleserlichen Inschriften lesbar wurden. "Dennoch waren mir die Informationen zu spärlich. Ich hätte gern mehr dazu erfahren." Er fing an zu recherchieren und fand ein Buch mit den alten Tauf- und Eheschließungsverzeichnissen. "Als ich das gesehen habe, lag für mich der Versuch nahe, herauszufinden, ob man etwas über das Schicksal dieser Leute herausfinden kann." Er suchte mit den Namen auf den Grabsteinen deren Eltern, Geschwister, Kinder, Ehepartner und entdeckte die verborgenen Familiengeschichten dieser Menschen. "Das ist das Faszinierende, das Spannende – dass die Schicksale nicht nur einzelner Personen, sondern ganzer Familien über Generationen hinweg deutlich werden."
Zwei Jahre arbeitete sich Reich, der früher leitender Angestellter in Banken und einem Industrieunternehmen war, intensiv durch diese Lebensgeschichten, die so erstmalig recherchiert wurden. Zwar gibt es heute neben einigen der Steine einen QR Code, hinter dem sich einige Informationen zu dem Grabstein verbergen, aber Reich hat mehr über die oft fesselnden Lebensgeschichten herausgefunden. Sein geplantes Buch stellt auch die einzelnen Grabsteine fotografisch vor. "Ich bin manchmal morgens um sieben am Friedhof gewesen, um entsprechende Lichtstrahlen und Schattenwürfe einzufangen."
Die sprechenden Grabsteine seien ein wichtiges kulturelles Erbe, meint Reich. "Nicht nur in der Hauptsaison sind ständig Gäste auf dem Friedhof zu sehen." Er biete eben doch ein Stück mehr als nur bloße Steine – wenn man sich näher mit den Lebensgeschichten dieser Menschen beschäftigt, findet Reich. "Das Nachdenken über das Leben und über die Generationen dieser Menschen, die hier begraben sind, macht uns die Endlichkeit unseres eigenen Lebens sichtbar."