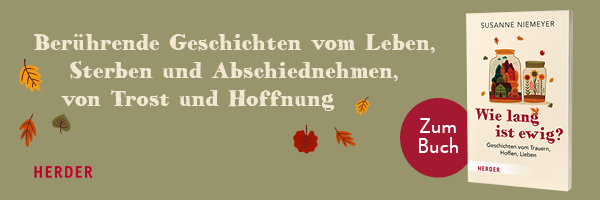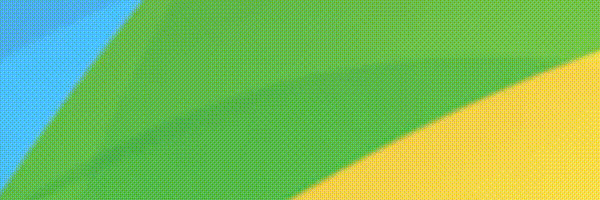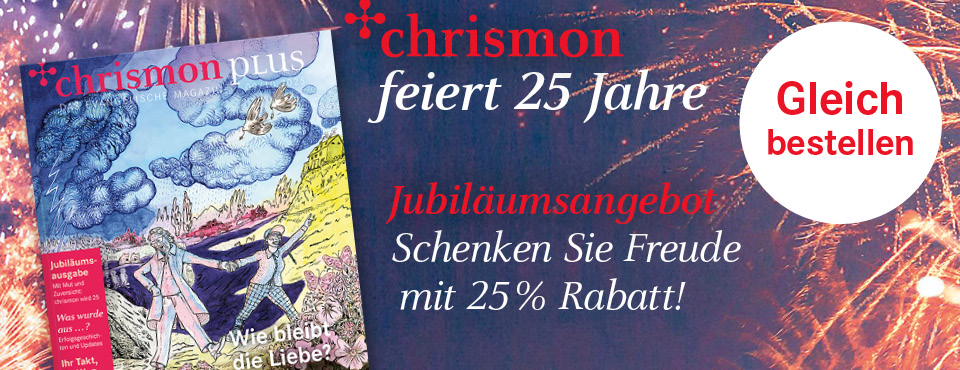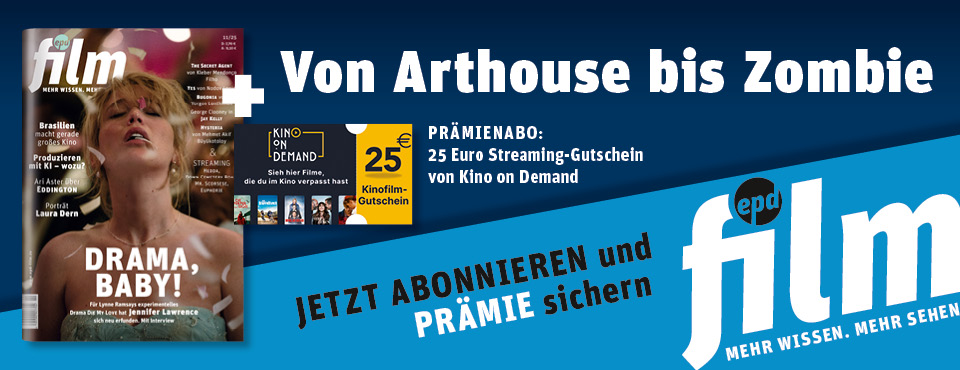Ulf Wellner setzt sich an die Orgel auf der Empore der Lüneburger St. Johanniskirche. Der Kirchenmusikdirektor tritt in die Pedale des Instrumentes und spielt den tiefsten Ton an. Die Orgelpfeife, die ihn erzeugt, ist 32 Fuß und damit fast zehn Meter lang. Ihr Klang sorgt für ein Kribbeln im Bauch. Wellner gerät ins Schwärmen, wenn er die Besonderheiten der fast 500 Jahre alten Orgel aufzählt. Von September an soll sie für rund 2,2 Millionen Euro restauriert werden.
Die Renaissance-Orgel in Lüneburgs evangelischer Hauptkirche wurde zwischen 1551 und 1553 von Hendrik Niehoff aus dem niederländischen Brabant gebaut. Eine barocke Erweiterung erhielt sie zwischen 1712 und 1715 durch Matthias Dropa, einem Schüler des bedeutendsten Orgelbauers des norddeutschen Barocks, Arp Schnitger. Dropa fügte unter anderem die mächtigen Pedaltürme hinzu, die dem Instrument sein heutiges Gesicht geben und zugleich statisch eine Herausforderung bedeuten. "Das war auch eine Erweiterung der musikalischen Möglichkeiten", sagt Kirchenmusikdirektor Wellner.
Die mehrjährige Restaurierung solle deshalb die Orgel bei höchstem technischem und historischem Anspruch in den Zustand dieser Zeit zurückversetzen: "Niehoff aus den Händen Dropas", sagt Wellner dazu. Das Instrument sei die letzte niederländische Renaissance-Orgel, die es im Grundbestand noch gebe, und gehöre zugleich zu den großen norddeutschen Barockorgeln von Weltruhm. Doch durch spätere Umbauten 1852 gab es Veränderungen, die das Instrument immer weiter von seiner ursprünglichen Ästhetik entfernten.
Schon der junge Bach spielte darauf
Zu den Besonderheiten der Orgel gehört, dass schon der junge Johann Sebastian Bach darauf spielte. Im Frühjahr 1700 kam der damals 15-jährige spätere Komponist für zwei Jahre als Schüler ans Michaeliskloster nach Lüneburg. In St. Johannis unterrichtete ihn Georg Böhm (1661-1733), damals einer der wichtigsten Organisten im norddeutschen Raum. Man spricht deshalb auch von der Bach-Böhm-Orgel. "Es waren prägende Jahre für Bachs künstlerische Persönlichkeit", ist Wellner überzeugt.
Der Kirchenmusikdirektor schlägt noch einmal den tiefsten Ton der Orgel an, gemeinsam mit weiteren Pedalregistern, einer zusammengehörigen Gruppe von Pfeifen mit gleicher Tonfärbung. "Ein solches Register gibt es weltweit nur noch dreimal", schwärmt er. "Und dieses ist das Beste. Es ist so elegant. Bach hätte gesagt, es hat Gravität - eine würdevolle Schwere."
Mit der Lüneburger Orgel geht laut Wellner auch ein Zeitalter zu Ende, in dem alle bedeutenden Instrumente des norddeutschen Raumes im Stil ihrer Erbauer restauriert wurden. Prägend dafür ist die Firma Ahrend aus dem ostfriesischen Leer, deren Werkstatt auch die Arbeiten in Lüneburg übernimmt. Der heutige Inhaber Hendrik Ahrend erläutert, schon Mitte der 1950er Jahre hätten sein Vater Jürgen und dessen damaliger Partner Gerhard Brunzema neue Wege eingeschlagen, anstatt tausende historische Pfeifen umzuarbeiten, um sie dem vorherrschenden Klangideal anzupassen.
Mit seinen aktuellen Restaurierungsplänen orientiert sich Hendrik Ahrend ebenfalls am historischen Vorbild. "Das Lüneburger Instrument wird zunächst wieder Windladen und Mechanik erhalten, wie man sie von Dropa und seinem Umfeld kennt", sagt er. Auch die Bleche für die Pfeifen würden nach historischer Methode in einer mit Sand gefüllten Gießlade gegossen. Aktuell seien in 31 erhaltenen Registern noch rund 940 Pfeifen erhalten, die noch aus der Zeit von Dropa oder älter sind. Rund ein Viertel der Pfeifen stammten damit aus ältester Zeit.
Nach der Rekonstruktion der verlorenen Stimmen wird die Zahl der Register wieder bei rund 50 liegen. Um das Projekt zu stemmen, haben die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, die hannoversche Landeskirche, Lüneburger Stiftungen und die Kirchengemeinde den Millionenbetrag aufgebracht. Angesichts der Bedeutung der "Königin der Instrumente" lohne das, ist Wellner überzeugt. Vom Kirchenschiff in St. Johannis fällt der Blick auf die teils mit Vergoldung schmuckvoll verzierten Prospektpfeifen. "In vielen anderen Kirchen sind solche Schätze den Bomben zum Opfer gefallen", sagt Wellner: "Oder sie wurden im Ersten Weltkrieg wegen des Zinnanteils eingeschmolzen."
Im September sollen erst einmal einzelne Pfeifen der Orgel abmontiert werden, bevor im Januar nächsten Jahres der Ausbau beginnt, wie der Kirchenmusikdirektor erläutert. Er wird dann die kleinere Chororgel der Kirche spielen, die aus dem Jahr 2010 stammt. Zu Pfingsten 2028 ist die Einweihung der restaurierten Königin der Instrumente geplant. Und Ulf Wellner ist überzeugt: "Sie wird Bestand haben, über Jahrhunderte."