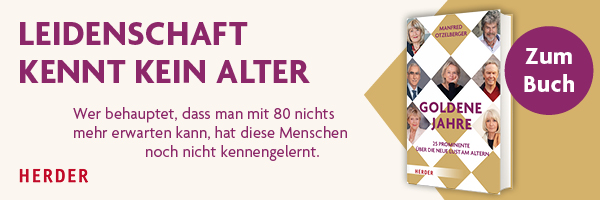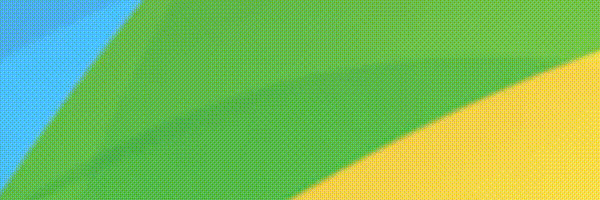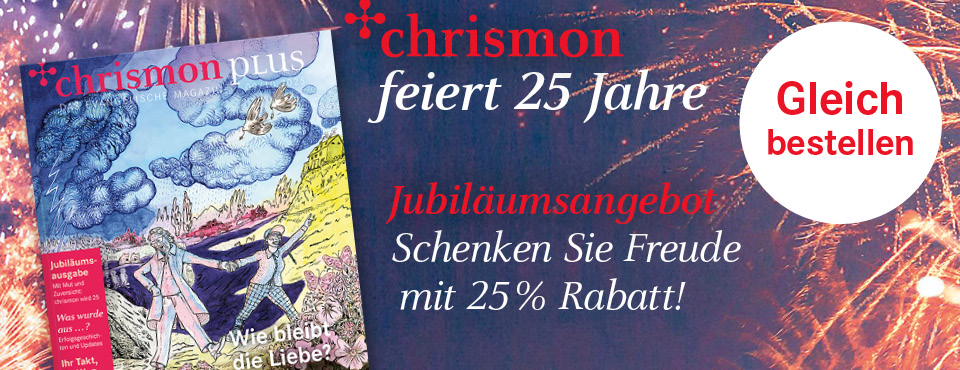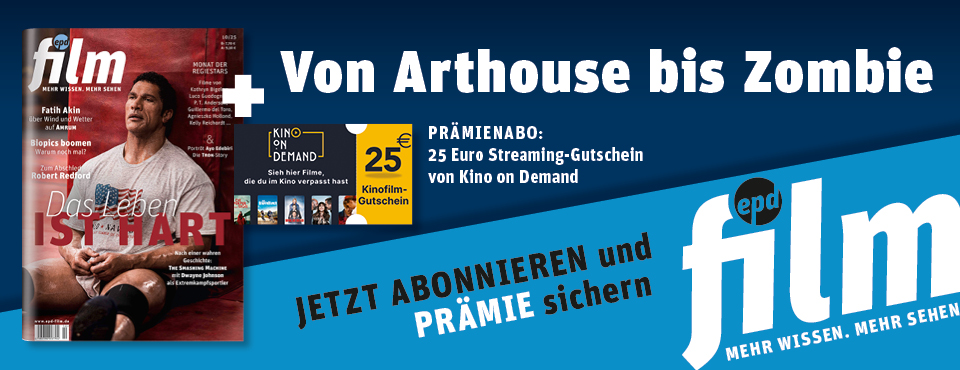Deutschland befinde sich nicht in einer militaristisch aufgeheizten Situation, wie einige Kritiker einer Wehrpflicht anführten. Für ihn gehe es um die Legitimität von Selbstverteidigung. Er selbst habe zwar den Kriegsdienst verweigert, aber nie infrage gestellt, dass sich ein Land verteidigen können müsse, sagte der 77-jährige Historiker, der den Friedenspreis am Sonntag zum Abschluss der Buchmesse in Frankfurt am Main überreicht bekommt. Seit der Annexion der Krim durch Russland 2014 sei der Krieg zurück in Europa. Dieser Realität müsse sich das Land stellen. Jede Initiative, die einen Weg zum Frieden ebnet, sei willkommen, sagte der Osteuropa-Experte. Leider gebe es kein Rezept für Frieden, dass sich aus der Historie ablesen lasse. "Geschichte wiederholt sich nicht", betonte Schlögel. Jede Situation sei anders.
Rückblickend sehe er die 60er bis etwa 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts als "Zwischenkriegszeit", sagte Schlögel. Die Annahme, dass mit dem Fall des Eisernen Vorhangs die Spannungen zwischen den politischen Blöcken beendet seien, habe sich leider als falsch erwiesen.
Deutschland solle der Ukraine alles an Waffen liefern, was ihr helfe, auch die Angriffsbasen der Russen außer Kraft zu setzen, sagte Schlögel. Innenpolitisch werde das nach seiner Einschätzung allerdings zu heftigen Auseinandersetzungen führen. Den russischen Präsidenten Waldimir Putin bezeichnete Schlögel als einen "Meister der Eskalation". Das Treffen mit dem US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump im August in Anchorage sei ein Erfolg für Putin gewesen. Es habe ihn als Gesprächspartner zurück auf die internationale Bühne gebracht. Seine Antwort auf die Einladung zu Verhandlungen sei das besonders heftige Bombardement der Ukraine in der darauffolgenden Nacht gewesen. Er sei gespannt, was ein mögliches Treffen von Trump und Putin in Budapest bringen werde.
Putin spreche bei stundenlangen, im Fernsehen übertragenen Gesprächen mit der Presse klare Drohungen gegen Europa aus. Er rede "ganz locker" über den möglichen Einsatz von Atomwaffen in Europa. Nach Schlögels Worten seien die Europäer für Putin "Störenfriede, die bekämpft werden" müssten, während er mit den Amerikanern "irgendwie klarkomme". Den "Putinismus" bezeichnete der Historiker als eine neue Situation, die nicht aus der Geschichte abzuleiten gewesen wäre. Aufgabe für Wissenschaftler und Beobachter vor Ort sei es nun, eine Sprache und Begriffe dafür zu finden, "womit wir es hier zu tun haben". Ähnliche verhalte es sich mit dem "Trumpismus".