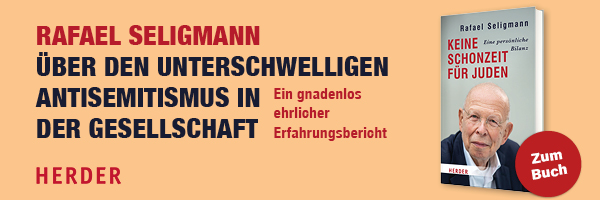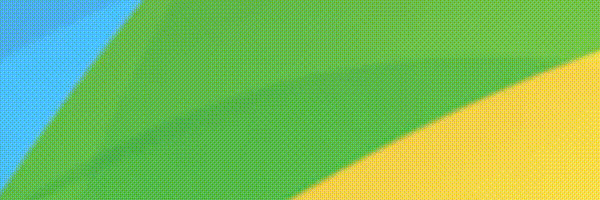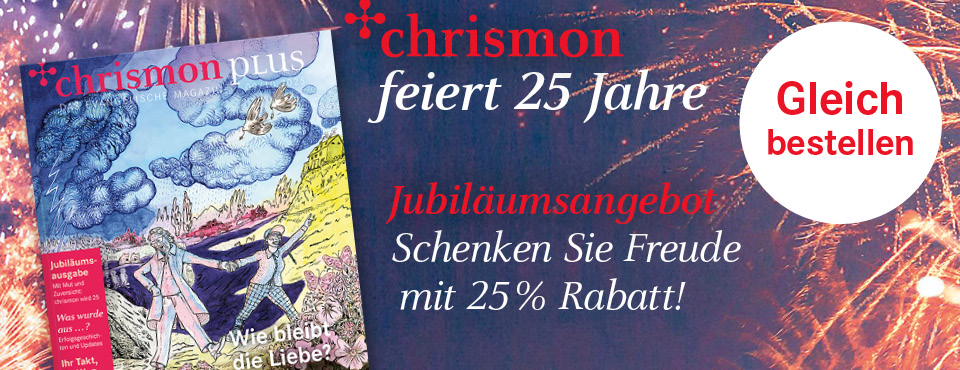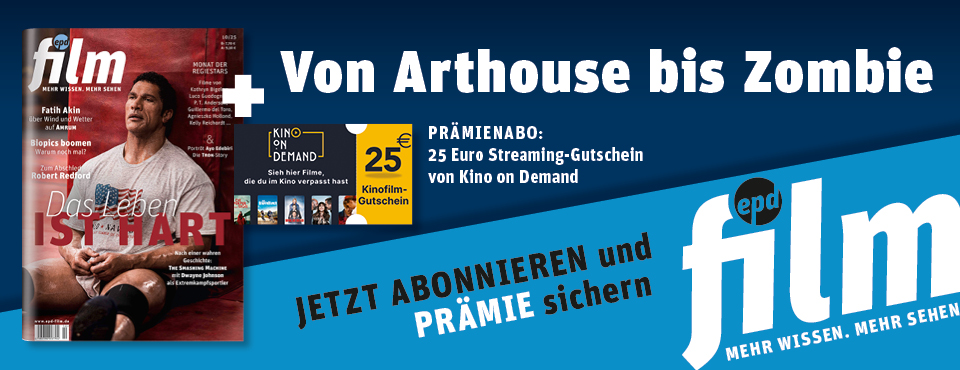Die Philosophin und Autorin Amani Abuzahra, Herausgeberin des Buches "Mehr Kopf als Tuch", sieht in der aktuellen Debatte einen Eingriff in die Religionsfreiheit und ein weiteres Zeichen für die Ausgrenzung von Muslimen in Österreich.
Frau Abuzahra, das islamische Kopftuch scheint ein immer wieder aufkommendes Thema zu sein, das von Politikerinnen und Politikern in Österreich, aber auch in Deutschland, aufgegriffen wird. Wie erklären Sie sich, dass das Kopftuch immer wieder im Zentrum politischer und gesellschaftlicher Debatten steht?
Amani Abuzahra: Weil Politik damit antimuslimischen Rassismus bedient und Kapital auf dem Rücken marginalisierter Gruppen schlägt. Immer wieder werden Themen, wie jetzt das Kopftuch, ins Zentrum gerückt, die in der Realität kein Problem darstellen, sich aber leider eignen, Emotionen zu schüren und Wähler:innen zu mobilisieren. Das Kopftuch wird nicht zufällig gewählt. Damit lenkt man von den eigentlichen Herausforderungen im Bildungs- und Sozialbereich ab.
Sie sehen darin also eine reine Symbolpolitik?
Abuzahra: Es ist mehr als das. Es ist eine symbolische Grenzziehung, die reale Konsequenzen hat. Symbolpolitik klingt harmlos, so als ginge es nur um Zeichen. Tatsächlich werden damit Zugehörigkeiten verhandelt: Wer gilt als Teil dieser Gesellschaft, wer nicht? Wenn der Staat ausgerechnet das Kopftuch von Musliminnen reguliert, signalisiert er, dass ihre Art, sichtbar zu sein, unerwünscht ist. Das ist eine subtile Form der Entwertung, die tief in das Selbstverständnis eingreift. Symbolpolitik wird hier zur Disziplinierungspolitik. Lehrervertreter:innen sprechen in diesem Zusammenhang übrigens von einer "krassen Themenverfehlung", weil sie sehen – und das ist ja längst bekannt –, dass Schulen mit ganz anderen Herausforderungen kämpfen: mit Personalmangel, überfüllten Klassen, psychischer Belastung, fehlenden Ressourcen. Gerade in einer Bildungspolitik, die selbst unter enormem Druck steht, ist es fatal, in Scheindebatten abzudriften, anstatt dort anzusetzen, wo tatsächliche Probleme liegen.
Die österreichische Politik sieht jedoch darin oft eine emanzipatorische Pflicht.
Abuzahra: Ein Kopftuchverbot ist kein Beitrag zur Emanzipation, sondern eine Form von Ausgrenzungspolitik. Mädchen, die Kopftuch tragen, werden nicht befreit, sondern stigmatisiert. Wenn Schule ein Spiegel der Gesellschaft ist, dann dürfen wir nicht dort anfangen, muslimische Kinder auszugrenzen. Ein Verbot signalisiert, dass bestimmte Ausdrucksformen unerwünscht sind, und es trifft immer dieselbe Gruppe. Im pädagogischen Sinne arbeitet man anders, um Menschen zu empowern. Doch nicht mit Verboten und Kriminalisierung.
Sie sprechen oft von "Empowerment" statt von "Integration". Was meinen Sie konkret damit und in welchem Verhältnis steht dieser zum Begriff "Integration"?
Abuzahra: "Integration" ist ein Begriff, der oft von oben gedacht wird – von einer Dominanzgesellschaft, die vorgibt, wie Teilhabe auszusehen hat. "Empowerment" hingegen betrachte ich aus einer anderen Perspektive: Es geht darum, Menschen in ihrer Handlungsmacht zu stärken und ihnen Räume zu eröffnen, in denen sie selbst bestimmen können, wer sie sind und wie sie leben wollen. Empowerment fragt nicht: "Wie wirst du Teil der Gesellschaft?", sondern: "Wie gestalten wir gemeinsam eine Gesellschaft, die gerechter ist?
Ich setze bewusst auf Empowerment, weil es nicht auf Integration (womit meist oft Assimilation gemeint ist) setzt, sondern auf Selbstermächtigung, Solidarität und strukturelle Veränderung. Musliminnen sind vollwertige Subjekte mit eigener Stimme, eigener Biografie und eigenem Anspruch auf Handlungsmacht. Dass wiederum die Gleichbehandlungsanwaltschaft erst kürzlich auf "grobe Verfassungswidrigkeiten" hinweist, wenn ein solches Verbot pauschal eingeführt wird, zeigt doch deutlich: Es geht um Fragen der Grundrechte, Fragen der Religion, Sichtbarkeit, aber auch Gleichbehandlung.
Man könnte allerdings argumentieren, dass das Verbot auch mit islamisch-theologischen Positionen vereinbar ist. Viele Gelehrte betonen, dass das Kopftuch für Mädchen keine religiöse Pflicht darstellt – und der Gesetzesentwurf betrifft ja Mädchen bis zur 8. Schulstufe. Wie sehen Sie das?
Abuzahra: Das ist richtig. Islamisch-theologisch gibt es keine Verpflichtung für Kinder, ein Kopftuch zu tragen. Aber das heißt nicht, dass der Staat darüber entscheiden sollte. Religiöse Praxis ist vielfältig und wird in Familien unterschiedlich gelebt. Für viele hat es spirituelle Bedeutung. Entscheidend ist doch, dass Kinder in einer offenen Gesellschaft selbstbestimmt aufwachsen können. Ein staatliches Verbot verhindert genau diese Selbstbestimmung. Außerdem: Seit wann spielt die islamisch-theologische Perspektive eine Rolle in der politischen Debatte? Das sind Scheinargumente.
Wenn es um Religion im öffentlichen Raum geht, scheint das Kopftuch immer wieder im Mittelpunkt zu stehen – über die Kippa oder das Kreuz wird dagegen kaum gesprochen. Warum ist das Ihrer Meinung nach so?
Abuzahra: Weil es Politiker:innen beim Kopftuch nicht um Religion geht, sondern um das Verhandeln vom Umgang mit Migration, Islam und die Konstruktion des "Anderen". Das Kopftuch wird bewusst zu einem Marker für eine "fremde" Religion missbraucht und zum Symbol für das, was vermeintlich nicht dazugehört. Genau diese ungleiche Behandlung religiöser Symbole zeigt, dass es nicht um Neutralität geht, sondern um Machtfragen.
Ein Verbot greift in das Grundrecht auf Religionsfreiheit ein, weil es Kindern und Eltern untersagt, ihre Religion so zu leben, wie sie es für richtig halten. Gleichzeitig ist es ein Ausdruck von strukturellem Rassismus, weil es ausschließlich Muslim:innen trifft und negative Bilder über "die Anderen" reproduziert. Solche Gesetze sind nie neutral. Sie richten sich gegen Marginalisierte und verstärken bestehende Ungleichheiten.
Sie haben ein Buch zu dieser Thematik herausgegeben, in dem Frauen ihre Sichtweisen und Erfahrungen teilen. Wenn Sie mit Frauen und Mädchen sprechen, die selbst Kopftuch tragen – welche Erfahrungen teilen sie mit Ihnen? Und was bedeutet das Kopftuch für sie persönlich?
Abuzahra: Muslim:innen und viele Mädchen nehmen die Situation als Katastrophe wahr. Während alle anderen Kinder sich durch unterschiedliche Identitäten ausprobieren dürfen, wird muslimischen Mädchen genau dieses Recht abgesprochen. Sie spüren, dass auf ihrem Rücken Politik gemacht wird. Für mich zeigt das, es geht nicht darum, Frauen und Mädchen in ihrer Selbstbestimmung ernst zu nehmen, sondern sie für machtpolitische Interessen zu instrumentalisieren.
In Medienberichten, aber auch von Politiker:innen, wird das Kopftuch häufig mit Begriffen wie "Zwang", "Unterdrückung" oder "Rückständigkeit" verbunden. Wie prägt diese Sprache das gesellschaftliche Klima?
Abuzahra: Diese Sprachwahl schadet auf doppelter Ebene: Zum einen entmenschlicht sie die Trägerinnen, sie werden nicht mehr in ihrer Vielschichtigkeit gesehen, sondern auf ein Kleidungsstück reduziert. Wenn man über muslimische Frauen permanent in Kategorien von Zwang und Unterdrückung spricht, verhindert man, dass sie überhaupt als denkende, handelnde Subjekte wahrgenommen werden. Zum anderen setzt sie die Norm fest: Wer nicht in dieses Narrativ passt, gilt als Problem. Sprache formt Wirklichkeit und in diesem Fall produziert sie eine, in der Musliminnen zum Projektionsfeld für Ängste werden. Das beschädigt nicht nur ihr Selbstbild, sondern auch das gesellschaftliche Zusammenleben, weil es eine Hierarchie der Menschlichkeit etabliert: Die einen gelten als zu befreiende Objekte, die anderen als befähigte Subjekte.
Wenn ein Gesetz nun mit "Kindeswohl" argumentiert und lehrende Personen kritisieren, dass andere Probleme (digitale Bildungsdefizite, Ressourcenmangel etc.) nicht einmal angegangen werden, dann zeigt sich: Der Diskurs über das Kopftuch wird instrumentalisiert, während strukturelle Fragen unerwähnt bleiben und damit nicht gelöst werden. Das Ergebnis ist ein gesellschaftliches Klima, in dem muslimische Mädchen und Frauen gezwungen werden, sich zu rechtfertigen, und nicht einfach als Menschen mit vielen Facetten wahrgenommen werden. Ich halte diese Reduktion für gefährlich: Sie verengt den Blick, erzeugt Druck und schwächt sowohl das Selbstvertrauen als auch die plurale Gesellschaft.
Was wäre für Sie ein konstruktiver Weg, um über Religion, Geschlecht und gesellschaftliche Vielfalt zu sprechen, ohne Vorurteile zu reproduzieren?
Abuzahra: Zuerst müssen wir aufhören, über Muslim:innen zu sprechen, und beginnen, ihnen zuzuhören. Ein konstruktiver Diskurs braucht neben Zuhören auch geteilte Deutungshoheit und institutionelle Verantwortung. Das bedeutet dann, dass Medien und Politik Räume öffnen, in denen muslimische Perspektiven nicht nur reagieren, sondern gestalten.
Ein konstruktiver Weg beginnt also damit, die Debattenebene zu verschieben: hin zu den Lebensrealitäten. Beispielsweise: Was heißt es für ein Mädchen in der achten Schulstufe, sichtbar muslimisch zu sein? Welche Räume fehlen? Welche Ängste hat sie vor Diskriminierung, Ausschluss? Und wir müssen lernen, Ambivalenz auszuhalten. Vielfalt ist kein harmonisches Narrativ, sondern ein Prozess der Aushandlung. Wenn wir uns trauen, Komplexität nicht sofort aufzulösen, entstehen neue Formen des Miteinanders, jenseits von Stereotypen und Machtgefällen.