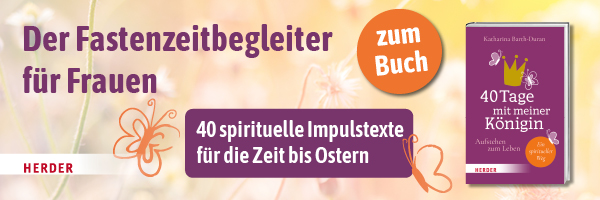Er hat in exakt 221 Kino-, Fernseh- und Serienproduktionen mitgewirkt, das Deutsche Filmmuseum rechnete das einmal genau nach. Eine Zahl, die dem vielleicht beliebtesten deutschen Schauspieler so schnell keiner nachmacht. Seine Beliebtheit hat sich Mario Adorf gerade auch mit seinen Bösewichten erworben, etwa dem Schurken Santer im ersten "Winnetou"-Film. Dass er die Schwester des edlen Apachen erschießt, hat ihm viele Beschimpfungen eingebracht, wie er häufiger erzählt hat. In der Fernseh-Serie "Kir Royal" war er ein rücksichtsloser Fabrikant. "Isch scheiß' dich sowat von zu mit meinem Geld", heißt es im legendären Monolog des Provinzindustriellen.
Auch die Rolle, die ihn bekannt machte, war ein Bösewicht: der Massenmörder Bruno in Robert Siodmaks "Nachts, wenn der Teufel kam" (1957). Das erschreckende Porträt eines ebenso naiven wie mörderisch-gefährlichen jungen Mannes in der Zeit des Nationalsozialismus geriet zu seiner ersten großen künstlerischen Leistung. Kritiker haben sie immer wieder mit der von Peter Lorre in Fritz Langs "M - Eine Stadt sucht einen Mörder" verglichen. Der Mörder Bruno war Adorfs elfte Filmrolle innerhalb von nur drei Jahren. Seinen ersten Kinoauftritt hatte er in dem deutschen Spielfilm "08/15", im Jahr 1954.
Nach seiner Entdeckung wurden ihm Schlag auf Schlag interessante Rollen angeboten. 1958 war Adorf der freche Bänkelsänger in Rolf Thieles Wirtschaftswunder-Satire "Das Mädchen Rosemarie", 1959 der intelligente "Kopf" einer Berliner Jugendbande in Gerd Oswalds "Am Tag als der Regen kam". In Georg Tresslers Verfilmung von Travens Roman "Das Totenschiff" (1959) gab er den Matrosen Lawski mit einer für das damalige deutsche Kino unbekannten ungeheuer starken physischen Präsenz. Vielleicht kam ihm dabei zugute, dass er vor seiner Schauspielerkarriere Boxer war.
Geboren wurde Mario Adorf 1930 in Zürich als Sohn eines italienischen Vaters und einer deutschen Mutter, bei der er in der Eifel in armen Verhältnissen aufwuchs. In den 50er Jahren studierte er in Mainz und in Zürich quer durch fast alle Wissensgebiete und begann, Fremdsprachen zu lernen. Das erleichterte ihm seine spätere Laufbahn sehr: Adorf spricht neben Deutsch perfekt Englisch, Französisch und Italienisch. Er gehörte zu den Schauspielern, die in den 50er Jahren den Mief dieser Zeit aus dem deutschen Kino jagten. Und er gehörte zu den wenigen, die auch international Fuß fassen konnten. In Hollywood spielte er schon 1964 in Sam Peckinpahs Western "Major Dundee" - wenn auch seine Rolle durch die Kürzungen des Studios damals arg dezimiert wurde.
Von Münchner Kammerspielen nach Hollywood
Als Bösewicht hat er den internationalen Karl-May-Produktionen seinen Stempel aufgedrückt und wirkte auch in Filmen mit, die unter seinem Niveau lagen, in Mafia-Thrillern und Komödien, meist in seiner damaligen Wahlheimat Italien. Viele Rollen hat er auch ausgeschlagen, bei Billy Wilder oder Francis Ford Coppola etwa. Zugleich trat er auch immer wieder im Theater auf, Adorf hatte in den 50er Jahren an den Münchner Kammerspielen begonnen und die Liebe zur Bühne nie verloren.
In der Bundesrepublik entdeckte ihn allmählich der junge deutsche Film. Dieser Sprung gelang nur wenigen Darstellern, die in den 50er Jahren begonnen hatten. Er spielte bei Volker Schlöndorff in "Die verlorene Ehre der Katharina Blum" (1978) und "Die Blechtrommel" (1979) und bei Fassbinder in "Lola" (1981). Sogar dem Regie-Rigorismus von Danièle Huillet und Jean-Marie Straub setzte er sich in deren Kafka-Adaption "Klassenverhältnisse" aus. Aber alle diese Auftritte waren im Grunde Gastrollen, wirklich präsent wurde er in Deutschland erst wieder in den 90er Jahren in großen Fernseh-Serien. Damit begann eine glänzende Alterskarriere, vor allem in den von Dieter Wedel inszenierten Mehrteilern "Der große Bellheim" und "Der Schattenmann".
Brillant auch sein Auftritt als Wirt in dem Kinofilm "Rossini" von Helmut Dietl. Adorf hat in diesen Jahren, wie Dieter Wedel es formulierte, den "Schritt vom Schauspieler, der häufig Charakterrollen spielt, zum Mittelpunktschauspieler vollzogen". Und er ist das geworden, was er wegen seiner Qualität und Kamera-Präsenz eigentlich schon immer war: ein Star.
Auch im neueren deutschen Kino hat Adorf, der seine Auftritte immer ohne Allüren meisterte, seine Spuren hinterlassen: in kleinen, aber prägnanten Auftritten in den beiden Jugendfilmen "Die rote Zora" (2008) und in Detlev Bucks "Same Same but Different" (2009) etwa, oder als KZ-Überlebender in "Der letzte Mentsch" (2014).
Er kenne sich aus im deutschen Kino und sei offen für die Jungen, hat er zuletzt immer wieder betont. Adorf ist in zweiter Ehe verheiratet, seine Tochter Stella ist auch Schauspielerin. Es gibt kaum einen Preis für einen Schauspieler, den er nicht gewonnen hätte: den Bambi, das Filmband in Gold, den Ernst-Lubitsch-Preis, den Bayerischen Fernsehpreis, die Carl-Zuckmayer-Medaille, den Grimme-Preis und den Ehrenpreis des Festivals von Locarno. Den Deutschen Fernsehpreis konnte er im letzten Jahr allerdings nicht persönlich entgegennehmen. "Mit 94 darf man auch mal krank sein, oder?", sagte er.