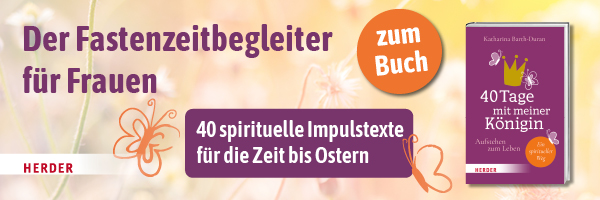"Wenn du einen Garten und eine Bibliothek hast, wird es dir an nichts fehlen", soll der römische Philosoph Cicero einst formuliert haben. Der Garten als Oase und Sehnsuchtsplatz, als Rückzugsort und kleines Paradies. Was lange Zeit als Inbegriff der Spießigkeit und Domäne von Rentnern galt, erlebt seit mehreren Jahren einen Wandel: Schrebergärten entwickeln sich zum "it-place". Und der Trend hält an: Gerade in Großstädten und Ballungszentren sind die Parzellen so gefragt wie lange nicht, weiß Sandra von Rekowski vom Bundesverband der Kleingartenvereine Deutschlands in Berlin.
"Insbesondere während und nach der Corona-Pandemie war ein starker Anstieg der Nachfrage zu beobachten, da viele Menschen Erholung im Grünen und eine Rückzugsmöglichkeit suchten", sagt sie im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd). In Zeiten von Beschränkungen und Verboten sei der Garten ein Stück Freiheit gewesen. Anders als zunächst erwartet, ist das Interesse auch nach der Pandemie ungebrochen - besonders junge Leute und Familien entdecken den Reiz des Gärtnerns neu.
"Nachhaltigkeit und Do it Yourself sind voll im Trend - Gemüse selbst anbauen ist cool statt spießig", sagt Rekowski. In den sozialen Medien zeigten User, wie individuell und stylisch Schrebergärten gestaltet werden können. Urban Gardening, "Zurück zur Natur" und Selbstverwirklichung im Grünen seien Themen, die längst auch die Millennials und die Generation Z erreicht hätten. Der Garten sei für viele ein Kreativlabor, ein Ort des Miteinanders und zugleich die stille Abkehr von der hektischen Stadt.
Monatlich bis zu 30 Anfragen von Interessenten
Diesen Imagewandel bestätigt auch die Wissenschaft. Nina Schuster, Soziologin aus Dortmund, hat sich mit der Funktion von Kleingärten für die Gesellschaft beschäftigt. Nach ihren Worten hat sich das Bild des Kleingartens gewandelt - weg vom vermeintlichen Spießeridyll hin zum persönlichen Projekt als "romantisch verklärte Selbstverwirklichungsoase, die die Individualität und Kreativität der Nutzer widerspiegelt". Die Parzelle sei für viele längst Teil eines modernen, individualisierten Lifestyles.
Ursprünglich ging es bei den Gärten um Selbstversorgung: Die ersten Kleingärten hatte Pfarrer H. F. Schröder 1814 auf Pastoratsland in Kappeln an der Schlei verpachtet. In Berlin entstanden "Rotkreuzgärten", "Arbeitergärten" und "Eisenbahnergärten".
Die bekannteste Tradition beruft sich auf den Leipziger Orthopäden Moritz Schreber, auf dessen Anregung hin ein Schulverein für Arbeiterkinder entstand. Ein Lehrer legte auch Gärten für Kinder an, die bald von den Eltern okkupiert, parzelliert und eingezäunt wurden: die ersten "Schrebergärten". Als die Initiative 1869 hundert Parzellen umfasste, gab sie sich eine Vereinssatzung.
Heute gibt es rund 14.000 Kleingartenanlagen in Deutschland. Wer dort gärtnern möchte, braucht Geduld. Bei der Stadt Stuttgart liegt die Wartezeit bei zehn bis zwölf Jahren - fast so lang wie einst in der DDR auf ein Auto. Monatlich gingen bis zu 30 Anfragen von Interessenten ein, heißt es vom Liegenschaftsamt der Stadt.
Nicht ganz so lange muss man sich beim Bezirksverband der Gartenfreunde Stuttgart gedulden. Der Verein betreut rund 3.000 Parzellen in 62 Gartenanlagen in der Landeshauptstadt. "In der Regel können wir Interessenten innerhalb von zwölf Monaten einen Garten vorstellen", sagt Sabine Metzger, ehrenamtliche Geschäftsführerin des Vereins. Auch sie beobachtet, dass Interessenten jünger werden. Besonders für Familien mit kleinen Kindern, die mitunter beengt in der Stadt wohnten, bedeute ein Garten ein Stück Freiheit.
Für andere biete die grüne Oase in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten zunehmend eine Alternative zum teuren Jahresurlaub: Ein Tag zwischen Bäumen und Beeten seien wie kurze Ferien. "Wir möchten, dass die Pacht erschwinglich bleibt", sagt Metzger. "Luxusgärten wollen wir nicht fördern, sondern Gemeinschaft und Nachhaltigkeit."