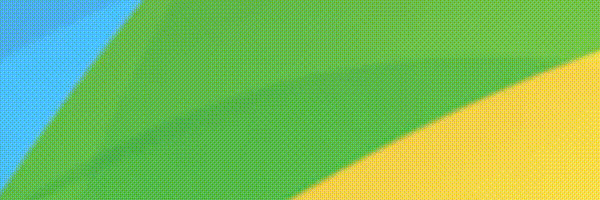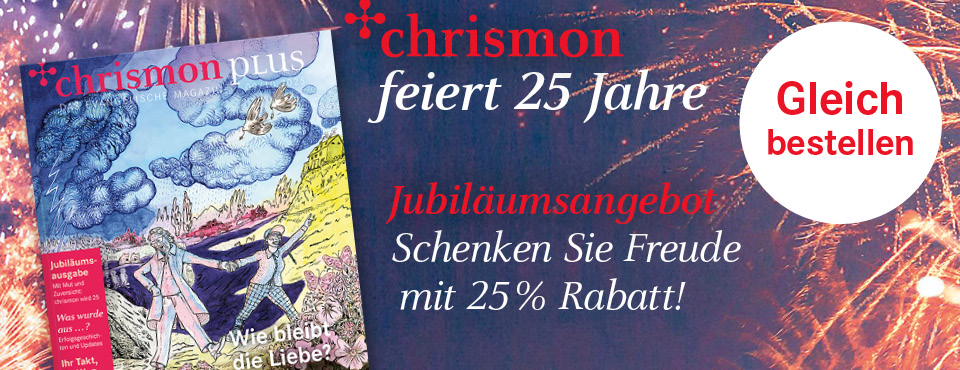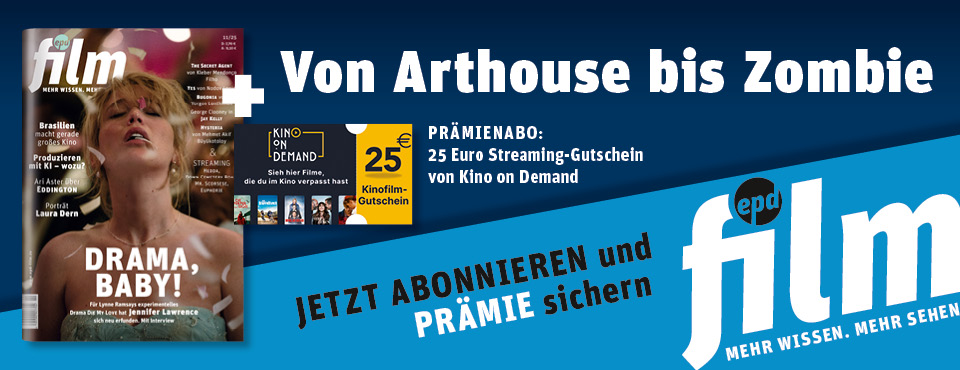Diese Tage läuft in den Kinos der neue Film "Jurassic World: Die Wiedergeburt" an. Auch abseits der Leinwand werden weitreichende technologische Eingriffe in die Natur immer wieder ernsthaft diskutiert: von der vermeintlichen Wiedebelebung des ausgestorbenen "Schattenwolfs" mittels Genom-Editing bis zum Geo-Engineering zur Abmilderung der Klimaerhitzung. Aus ethischer Sicht ist hier vielleicht der Einsatz des Genom-Editing im Kampf gegen die Malaria am interessantesten.
Hier lautet der Vorschlag, Stechmücken genetisch so zu modifizieren, dass sie gegen Malaria-Erreger immun werden und ihn nicht mehr auf den Menschen übertragen können. Stechmücken sind die gefährlichsten Tiere für den Menschen überhaupt, gefährlicher als Schlangen oder Löwen, vielleicht sogar gefährlicher als der Mensch selbst.
Laut Weltgesundheitsorganisation starben 2023 fast 600.000 Menschen an Malaria, die allein von der Stechmücke übertragen wird. Aufgrund des Klimawandels dürften Mücken die Malaria auch zunehmend in Deutschland übertragen, wenn auch längst nicht in dem Maße wie im Afrika südlich der Sahara oder in Indien.
Das gentechnische Verfahren
Ohne die Stechmücke könnte der Malaria-Erreger nicht auf Menschen oder Tiere übertragen werden. Nun könnte man mit der neuen Technologie des Genom-Editing zwei Schritte vollziehen. Erstens könnte man Stechmücken genetisch so modifizieren, dass der Erreger im Körper der Mücke nicht überlebt, so dass sie keine neuen Personen infizieren kann. Die Mücken würden immun gegen den Malaria-Erreger. Würden die modifizierten Mücken dann in der Natur ausgesetzt und dort die herkömmlichen Mücken verdrängen, gäbe es keine Malariaerkrankungen mehr. Aber für die Verdrängung des Wildtyps durch die modifizierten Mücken bedarf es noch eines zweiten Tricks.
Alexander Maßmann wurde im Bereich evangelische Ethik und Dogmatik an der Universität Heidelberg promoviert. Seine Doktorarbeit wurde mit dem Lautenschlaeger Award for Theological Promise ausgezeichnet. Publikationen in den Bereichen theologische Ethik (zum Beispiel Bioethik) und Theologie und Naturwissenschaften, Lehre an den Universitäten Heidelberg und Cambridge (GB).
Allein mit der einen Genmodifikation würden die modifizierten Mücken bald von den herkömmlichen Mücken verdrängt. In der freien Wildbahn würde, gemäß den Mendelschen Vererbungsregeln aus dem Bio-Unterricht, nur jede vierte neugeschlüpfte Mücke die Anti-Malaria-Modifikation erben. Aber man kann mit einer zweiten, etwas andersartigen genetischen Modifikation der Mücken die Prozesse des Erbgangs selbst verändern. Damit könnten wirklich alle Nachkommen der modifizierten Mücken die Immunität erben. Das ist der sogenannte "Gene-Drive", der Gen-Turbo. Jetzt würden modifizierte Mücken den Wildtyp konsequent verdrängen.
Risiken bei Genmodifikation
Damit steigt natürlich auch das Risiko: Was passiert, wenn die Genmodifikation unvorhergesehene Nebeneffekte hat? Natürlich muss man hier sachlich bleiben. Durch einen Mückenstich etwa werden keinerlei Gene übertragen. Aber: Falls die Genmodifikation die Mücke auf unvorhergesehene Weise verändert, könnte sich diese Eigenschaft dank Gene-Drive in der gesamten Mückenpopulation durchsetzen. Ein Nebeneffekt würde vielleicht irgendeine wichtige Anpassung der Mücken an ihre Umwelt kompromittieren, und nach und nach schrumpfen die Mückenpopulationen. Das wäre ein Problem für die Fressfeinde der Mücken, wie Vögel und Amphibien, die womöglich weniger zu Fressen fänden. Aber klar ist, dass aufwendige Tests unter kontrollierten Bedingungen nötig wären. Forscher:innen sammeln bereits Erfahrungen, zum Beispiel mit Mücken in großen Käfigen, die sie im Labor oder unter naturähnlichen Bedingungen kontrolliert testen und beobachten.
Der Kampf gegen Malaria beruht im Augenblick bereits auf mehreren Komponenten: Es werden Moskitonetze verteilt, die oft verhindern, dass eine Mücke an den Körper herankommt und sticht. Die Netze sind oft mit Insektiziden behandelt, die die Mücken töten können, wenn sie es zufällig in das Moskitonetz hineinschaffen. Auch andernorts versucht man, die Mückenpopulationen kleinzuhalten, indem man sie mit Insektiziden bekämpft. Außerdem ist die Malaria im Verlauf weniger schlimm, wenn die Bevölkerung Zugang zu guter medizinischer Behandlung hat.
Neuerdings gibt es auch vorbeugende Malaria-Impfungen. Bis vor kurzem war das nicht machbar. Ein Mittel, das nun eingesetzt wird, hat eine Schutzrate von etwa 30%. Die Anzahl der Kinder, die an Malaria sterben, hat unter Geimpften um 13% abgenommen. Ein weiteres, noch neueres Mittel soll angeblich eine Schutzrate von 75% statt nur 30% erbringen. Das ist allerdings noch unsicher. Dennoch: Wenn es bereits bestehende Ansätze in der Malaria-Prävention und -Behandlung gibt, braucht es dann überhaupt noch den Versuch, die Mückenpopulationen genetisch zu modifizieren, um die Verbreitung des Malaria-Parasiten zu bekämpfen?
Pro Gentechnik
Meiner Meinung nach kann der Kampf gegen die Malaria gar nicht zu viele Komponenten haben. Besonders wünsche ich den Malaria-Impfstoffen eine weite Verbreitung! Dennoch bestehen besondere Schwierigkeiten für die bestehenden Malaria-Programme. Der Kampf gegen die Malaria hat einige Erfolge zu verzeichnen, aber es bestehen auch Schwierigkeiten. Es geht um die Finanzierung, die biomedizinische Wirksamkeit bestimmter Maßnahmen und den möglichen Rückhalt bestimmter Optionen in der Bevölkerung.
Afrikanische Länder sind im Kampf gegen die Malaria auf Unterstützung aus dem Ausland angewiesen. Die USA sind einer der Hauptspender, aber Trump und Musk haben die Hilfsprogramme rigoros gekürzt. Eine Untersuchung fand jetzt heraus, dass amerikanische Hilfsprogramme gegen die Malaria in den letzten 21 Jahren etwa 80 Millionen Menschenleben gerettet haben. Deutschland hat gerade zum ersten Mal die internationale Verpflichtung nicht eingehalten, mindestens 0,7% der Wirtschaftskraft in die weltweite Armutsbekämpfung zu investieren, also in Entwicklungshilfe bzw. entwicklungspolitische Zusammenarbeit. Auch wenn sich die Malariabekämpfung von solchen Rückschlägen erholen sollte, bleibt die dauerhafte, verlässliche Finanzierung eine Achillesferse des gegenwärtigen Kampfes gegen die Malaria.
Hinzu kommt, dass Mücken allmählich resistent gegen Insektizide werden. Es wird in Zukunft schwieriger, Ansteckungen zu vermeiden, weil präventive Sprühkampagnen zur Tötung von Mücken weniger effektiv sein werden. Auch gegen bestehende Malariamedikamente können die Malaria-Erreger allmählich resistent werden. Und was die neuen Malaria-Impfungen angeht: Eine Person benötigt vier oder fünf Spritzen und genießt dann mehrere Jahre lang einen gewissen Schutz, wenn auch keine Immunität.
Die Impfung muss außerdem an die lokalen Malaria-Parasiten angepasst sein, wird also nicht überall die genannte Wirkungsrate erreichen. Außerdem zeigt das Beispiel der USA und Deutschlands, dass es bei Impfungen nicht bloß auf medizinische Kennzahlen auf dem Papier ankommt, sondern auch darauf, ob die Bevölkerung mitzieht. Wenn Populisten in Deutschland und in den USA Stimmung gegen Impfung machen können und dabei immense medizinische Schäden in Kauf nehmen, kann das auch in anderen Ländern passieren.
Die Perspektive der theologischen Ethik
Aber abseits der Abwägung von Chancen und Risiken: Was ist eigentlich theologisch von der gezielten Modifikation größerer Insektenpopulationen zu halten? Letztlich geht es um die gezielte Ausrottung des Malaria-Erregers. Die Öko-Enzyklika von Papst Franziskus, "Laudato sí" (2015), hält jeden Aspekt
der Schöpfung für schützenswert: Alles in der Schöpfung reflektiere einen Aspekt des Schöpfers selbst. Das hieße aber, dass auch der Malaria-Erreger, ein einzelliges Lebewesen (Plasmodium falciparum oder vivax), zu achten und zu schützen sei, ebenso wie die Bakterien, die die Pest verursachen oder das HI-Virus. Auch auf evangelischer Seite beharren einige Theologen auf einem Leben "im Einklang mit der gesamten Schöpfung".
Eine solche Schöpfungstheologie ist nicht sinnvoll. Wir kommen hier nicht um den Konflikt zwischen Menschen und Parasiten herum. Es klingt hässlich für manche, aber der Mensch ist mehr wert als bestimmte andere Geschöpfe. Ich würde zwar den Menschen nicht als die Krone der Schöpfung bezeichnen, aber aus moralischer Sicht können wir die altmodische Vorstellung von einer bestimmten Hierarchie in der Schöpfung nicht einfach ablehnen. Das heißt nicht, dass wir einen Freifahrtschein für beliebige Modifikationen anderer Spezies haben. Letztlich geht es hier um eine sorgfältige, verantwortungsvolle Abwägung von Nutzen und Risiken, die umsichtig ein Maß des ökologischen Gleichgewichts anstreben muss. Hinzu kommt das Kriterium der sozialen Gerechtigkeit. Wir müssen über die langfristigen Folgen des Handelns nachdenken, aber auch die Kosten des Nicht-Handelns einkalkulieren. Mit theologischen Ansichten kann man das nicht einfach verbieten.
Die Stakeholders vor Ort
Die höchste Hürde für die Ausrottung des Malaria-Erregers durch die Gentechnik dürfte aber in etwas anderem bestehen. Westliche Biotech-Initiativen können nicht einfach in Subsahara-Afrika landen und dort die Fauna dauerhaft verändern. Selbst wenn die Forscher:innen im Labor alle Sicherheitsmaßnahmen vorbildlich erfüllen, muss das letzte "OK" bei den "Stakeholders" vor Ort liegen. Wenn die lokale Bevölkerung den Eindruck erhält, hier greifen Fremde unvermittelt in ihre eigensten Lebensbedingungen ein, dann kann leicht Misstrauen entstehen auch gegen die vielen anderen Maßnahmen der Malariabekämpfung – selbst wenn die gar nichts zu tun haben mit der Gentechnik. Wenn etwa das Vertrauen in neue Impfkampagnen schwindet, gehen wieder viele Leben verloren, die man sonst hätte retten können.
Die Herausforderung von Bildung und Konsensfindung nehmen viele Forscher und Aktivisten bereits seit längerem sehr ernst. Gesellschaften vor Ort werden zum Beispiel mit Theaterstücken über die Möglichkeiten und Grenzen genmodifizierender Freilandmaßnahmen aufgeklärt. Wer sich für die Genmodifikation von Insekten zur Malariabekämpfung interessiert, sollte sich an dieser Stelle einbringen. Die wissenschaftliche Arbeit ist zugleich politisch. Hier könnten sich auch Kirchengemeinden und Konfessionen hilfreich einbringen.