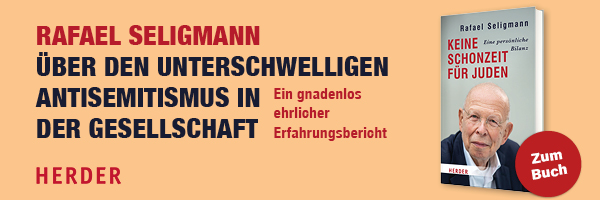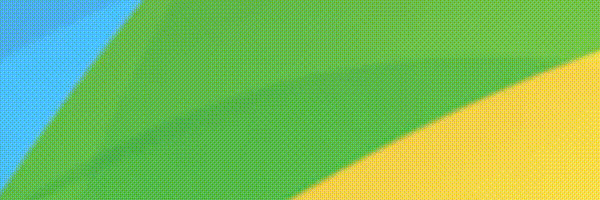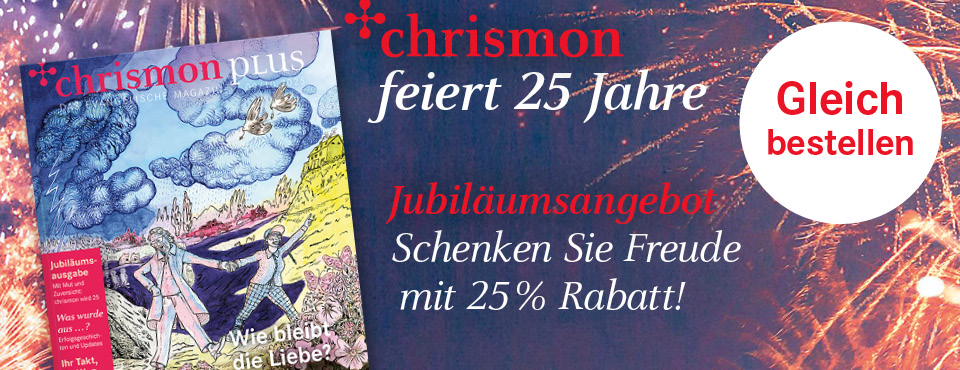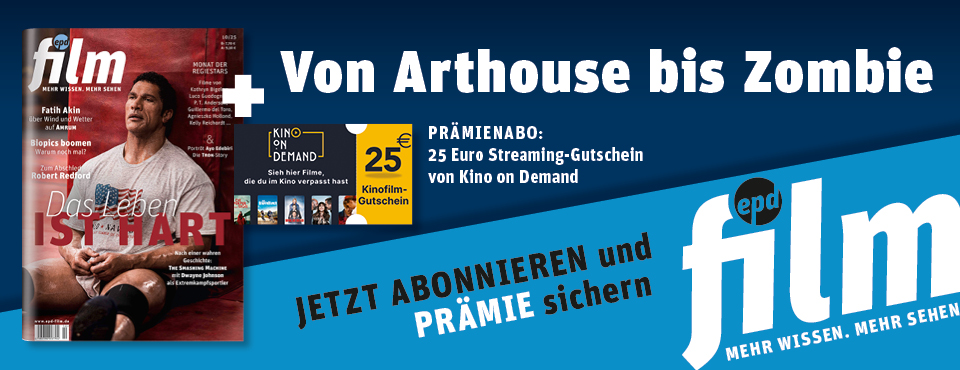Es geht um Leben und Tod - eine Patientenverfügung sollte daher nicht mal eben schnell mit Satzbausteinen und Vorlagen aus dem Internet verfasst werden. Denn Standarddokumente werden individuellen Wünschen oft nicht gerecht und können auch rechtlich unsicher sein.
Experten erläutern für den Evangelischen Pressedienst (epd), was beim Verfassen einer Patientenverfügung zu beachten ist, um Entscheidungen zu erleichtern.
Was regelt eine Patientenverfügung?
Eine Patientenverfügung wird im Voraus schriftlich für den Fall erstellt, dass ein Mensch nicht mehr selbst entscheiden kann, ob und wie er in bestimmten Situationen ärztlich behandelt werden möchte. Die gesetzliche Grundlage dafür ist Paragraph 1827 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB). Danach ist das Dokument für Ärzte und anderes medizinisches Personal verbindlich, sofern der darin formulierte Wille für eine konkrete Lebens- und Behandlungssituation eindeutig zum Ausdruck kommt.
In der Praxis ist das jedoch oftmals nicht der Fall: "Leider sind viele Patientenverfügungen in ihren Aussagen recht unklar", schildert Ulrike Olgemöller, Intensivmedizinerin in der Abteilung Kardiologie und Pneumologie der Universitätsmedizin Göttingen (UMG). Außerdem bestehe bei Ärztinnen, Ärzten und Angehörigen häufig Unsicherheit darüber, ob eine vor Jahren dokumentierte Patientenverfügung noch dem aktuellen Willen entspreche. Die Oberärztin rät daher, in bestimmten Abständen eine Aktualisierung des Dokuments vorzunehmen und beim Formulieren auf fachliche Beratung von Medizinern oder Beratungsstellen zu setzen. Die Patientenverfügung kann laut Gesetz jederzeit formlos widerrufen werden.
Wann und für wen ist eine Patientenverfügung überhaupt sinnvoll?
Hanna Giesen, Patientenberaterin und Sozialarbeiterin bei der Deutschen Stiftung Patientenschutz, empfiehlt: "Jede volljährige Person sollte ein solches Dokument besitzen. Denn ein schwerer Schicksalsschlag kann jeden treffen." Diese Erkenntnis dringe auch zunehmend in das Bewusstsein junger Menschen, die immer öfter Rat zum Thema Patientenverfügung suchten. Grund dafür ist aus Sicht der Patientenberaterin ein "gestiegenes Autonomiebewusstsein".
Was sollte eine Patientenverfügung beinhalten?
"Möglichst präzise beschrieben werden müssen darin die Behandlungssituationen, für die die Patientenverfügung gelten soll", führt Giesen aus. Das kann eine Gehirnschädigung sein oder das Endstadium einer unheilbaren Krankheit. Außerdem bedürfe es einer Auflistung von Behandlungen und Eingriffen, die in diesen Fällen gewünscht oder abgelehnt werden. Darunter fallen etwa Palliativversorgung oder künstliche Ernährung.
Formulierungshilfen und Vorschläge, was alles an Themen aufgenommen werden kann, gibt etwa das Bundesjustizministerium auf seiner Website. Um sicherzugehen, dass eine Patientenverfügung medizinisch und juristisch Bestand hat, bietet die Deutsche Stiftung Patientenschutz eine gebührenfreie Prüfung des Dokuments an.
Wo sollte die Patientenverfügung aufbewahrt werden?
Wichtig ist den Experten zufolge, dass auf die Patientenverfügung möglichst schnell zurückgegriffen werden kann, wenn sie benötigt wird. Daher sei ein sicherer Aufbewahrungsort wichtig, etwa in einem Notfallordner für Angehörige und Betreuer. Sinnvoll ist es auch, eine Kopie beim Hausarzt zu hinterlegen. Eine weitere Möglichkeit ist die Registrierung im Zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer.
Ist eine Vorsorgevollmacht sinnvoll?
Die Deutsche Stiftung Patientenschutz empfiehlt, zusammen mit der Patientenverfügung eine Vorsorgevollmacht und/oder Betreuungsverfügung aufzusetzen. Bevollmächtigte oder gerichtlich bestellte Betreuer können Patienten dann uneingeschränkt in medizinischen Fragen vertreten. Zwar gebe es seit 2023 ein sogenanntes Notvertretungsrecht für Ehe- und Lebenspartner in gesundheitlichen Krisen. Dieses Recht erlösche jedoch nach sechs Monaten, erläutert Patientenberaterin Giesen.