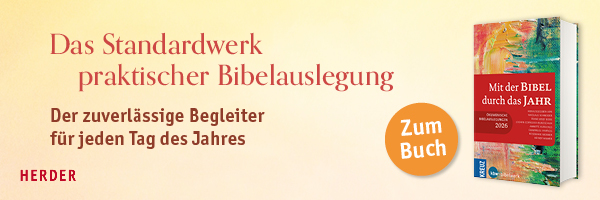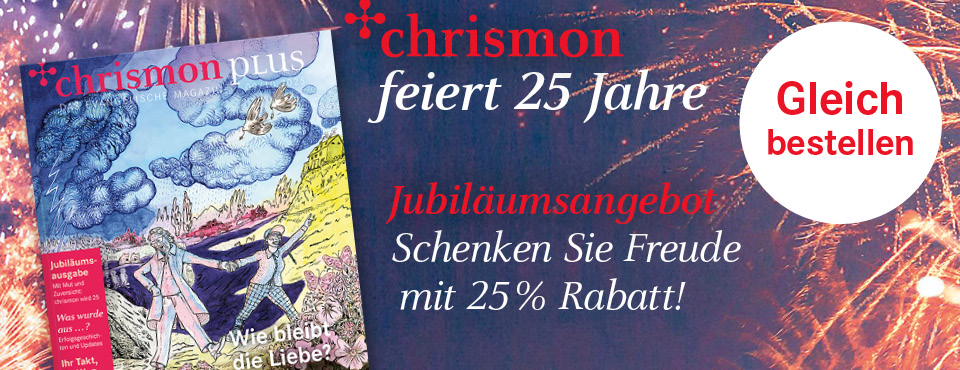epd: Schnell nur kurz eine Nachricht per Whatsapp statt Anruf, beim Treffen mit Freunden wird das Essen gepostet, persönliche Gespräche treten in den Hintergrund:
Höflichkeitsformen und das Miteinander scheinen in der digitalen Welt an Bedeutung zu verlieren. Ist das auch bei ernsten Themen wie dem Umgang mit Sterben und Tod zu beobachten?
Georg Schwikart: Ich sag es mal etwas pathetisch: Der moderne Mensch fühlt sich vom Tod gedemütigt. Wir haben weitgehend die - natürlich irrige - Vorstellung, alles machen und kontrollieren zu können. Der Tod allerdings ist eine andere Kategorie. Er zeigt uns unsere Grenzen auf.
Der Historiker Philippe Ariès zeigt auf, dass Religion früher den Tod "gezähmt" hat. Dieser Trost fehlt heutzutage oft. Das beeinflusst gravierend die Trauerkultur. Beerdigungen sollen so wenig wie möglich den normalen Fluss des Lebens stören, konkret: am besten am Montag oder am Freitag stattfinden, aber nicht während der Woche. Sich für die Trauerfeier einer Kollegin oder einer Nachbarin oder sogar des Opas freizunehmen, das ist ein echtes Opfer.
Aber um nicht nur über den Verlust der traditionellen Trauerkultur zu klagen: Es haben sich auch neue Formen entwickelt, die näher an den Zeitgenossen dran sind als althergebrachte Rituale. Es läuft andere Musik zur Beisetzung als früher. Luftballons steigen zu lassen, ist ein wunderbares Symbol. Vielleicht sagen Angehörige etwas sehr Persönliches, was alle rührt.
Sie haben sich auch als Religionswissenschaftler mit dem Thema Trauerkultur beschäftigt. Sind die Menschen heute mit dem Gedanken an den Tod überfordert?
Schwikart: Kohelet, der Prediger Salomo in der Bibel, bringt es in schlichte Worte: "Alles hat seine Zeit." Das Leben und das Sterben. Das Wissen um unsere Sterblichkeit unterscheidet den Menschen vom Tier. Buchstäblich jedes Kind weiß, dass alles, was lebt, einmal sterben wird. Die Frage ist, ob man den Tod als Verlust oder als Transformation begreift. Den Tod ins Leben zu integrieren ist eigentlich die große Stunde der Religion.
"Die Verdrängung des Jenseits macht das Diesseits auf jeden Fall nicht leichter"
In Thailand habe ich an einer buddhistischen Leichenverbrennung teilgenommen - großartig! Viele Menschen waren da, schauten in das Feuer, das den Leichnam vor unseren Augen verzehrte. Das kann man gut ertragen, wenn man vertraut, die Seele - also, was den Verstorbenen zu einer Persönlichkeit machte - ist längst raus. Dieses Individuelle kann man nicht "kremieren". Die Verdrängung des Jenseits macht das Diesseits auf jeden Fall nicht leichter.
Wenn junge Menschen sterben, ist die Anteilnahme oft sehr groß. Auch bei denen, die aus der Mitte des Lebens gerissen wurden - wahrscheinlich, weil es etwas Unvorhersehbares war, ein Schicksalsschlag. Aber wird nicht letztlich das "Werden und Vergehen" gesellschaftlich verdrängt?
Schwikart: Die Anspruchshaltung unserer Epoche ist grotesk: Die Menschen leben immer länger, viel länger als noch vor nur 200 Jahren. Die Säuglingssterblichkeit ist gravierend reduziert. Uns ist nach Kindheit, Jugend, Erwachsenenleben in der Moderne ein aktives Alter möglich. Da macht man Kreuzfahrten oder wird im Verein aktiv oder was auch immer. Dabei wird vergessen, irgendwann muss Schluss sein.
"Nur die Erfahrung der Trauer, also des Umgangs mit dem Tod, steht uns zur Verfügung"
Die Kehrseite der Medizin: Die letzte Phase kann ein Siechtum auf Raten sein. Sprüche wie "nun ist sie erlöst" oder "ist ja jetzt besser so", wenn eine Rentnerin verstorben ist, sind vor allem Ausdruck einer Sprachlosigkeit angesichts eines Phänomens, also des Todes, das uns überfordert. Der Tod ist ja per definitionem eine Erfahrung, die Lebenden fehlt. Nur die Erfahrung der Trauer, also des Umgangs mit dem Tod, steht uns zur Verfügung.
Viele wissen vielleicht auch nicht, wie sie mit Angehörigen einer oder eines Verstorbenen umgehen sollen. Gibt es da einen Trauer-Knigge? Was empfehlen Sie - etwa zur Auswahl der Trauerkarten und dem passenden Text oder zu dem Besuch einer Trauerfeier?
Schwikart: Der Begriff "Trauerfeier" ist eigentlich ein Widerspruch: Kann man die Trauer feiern? Ich sage: Ja. Sie ist ja ohnehin da, also gehe rein, gib dich ihr hin, gehe durch sie hindurch. Die Vorstellung, die Trauer würde kleiner, wenn die Feier kleiner gestaltet wird, ist seltsam. Auch der Wunsch, doch bitte nicht in Schwarz zu kommen, hilft nur bedingt: Es wird eine Normalität vorgegaukelt, die nicht existiert.
Angesichts einer Urne oder eines Sarges werden wir automatisch mit dem eigenen Tod konfrontiert. Zusammengefasst: Sei authentisch! Wenn du nichts zu sagen weißt, dann sage das doch einfach so. Besser als flotte Sprüche abzulassen, denen man anfühlen kann, "das glaubste doch selbst nicht". Die Worte sind letztlich nicht entscheidend, sondern das Zeichen: Ich weiche nicht aus, ich stelle mich dem Tod und der Trauer, ich gehe mit dir durch die Krise oder begleite dich mit guten Gedanken. Oder sogar mit meinem Gebet.
Dem biblischen Mythos nach sterben wir, weil Adam und Eva im Paradies gesündigt haben. Ich finde, wir können den beiden dankbar sein. Dieser Planet ist gut und schön, aber meine Neugier auf das Reich Gottes ist noch größer. Glaube heißt für mich, die Angst zu besiegen: Die Angst vor dem Leben und die Angst vor dem Tod.
Familien wählen zum Teil eine anonyme Bestattung, aus Sorge vor zu hohen Bestattungskosten oder weil die Verstorbenen der Familie nach dem Tod "nicht zur Last fallen wollen", etwa durch Grabpflege. Wirkt sich das auch gesamtgesellschaftlich auf eine Trauerkultur aus?
Schwikart: Es gibt Kommunen, die Rasengräber anbieten - also Flächen, in denen Urnen bestattet werden. Jeder Tote bekommt eine Grabplatte, aber eben nicht das klassische Grab mit Blümchen und aufrecht stehendem Grabstein. Es wird eher nicht nach anonymen Gräbern verlangt, sondern nach unkomplizierter Grabpflege. Das scheint verständlich, wenn die Eltern in Frankfurt auf dem Friedhof liegen, die Kinder aber in Berlin leben. Der Friedhofskult vergangener Zeiten war Forschungen zufolge auch nicht nur edel. Da ging es auch darum, Status zu markieren.
Heute besteht da eine große Offenheit. Die verschiedene Möglichkeiten setzen die Menschen allerdings auch unter Stress: Das typische Grab oder Kolumbarium oder Seebestattung oder soll die Asche verstreut werden. Dabei wird das den Toten gleichgültig sein. Die Lebenden machen sich ihre Gedanken. Ein Beispiel: Meine Frau möchte in den Friedwald, ich auf den normalen Friedhof. Grundsätzlich gut, wenn man solche Wünsche kennt. Aber die Überlebenden müssen damit leben. Ich mag nicht in den Wald gehen und vielleicht den Baum nicht wiederfinden, außerdem müsste ich mit dem Auto dorthin fahren. Kurzum, wir haben als Ehepaar eine einfache Regelung gefunden: Wer überlebt, bestimmt.