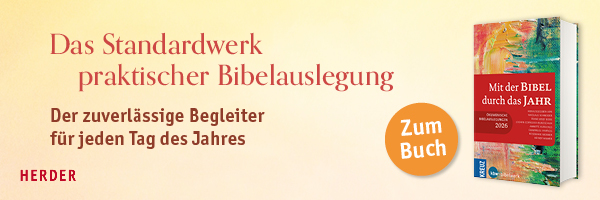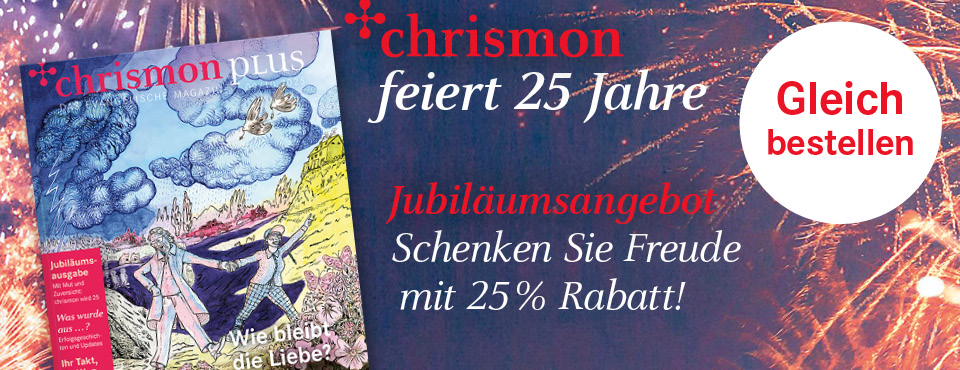Weil sie vom 16. bis ins 18. Jahrhundert hinein verfolgt wurden, zogen sich viele Täufer ins innere Exil zurück und lebten ihren christlichen Glauben nur im Privaten. Viele Gruppen wanderten aus, vor allem nach Nordamerika. Ihnen allen gemein ist die Erwachsenentaufe und ein strikter Pazifismus.
Am Sonntag wurde das 500-jährige Bestehen der Täuferbewegung mit einem Festakt und einem ökumenischen Festgottesdienst in Hamburg gefeiert. Zu den rund 400 Gästen des Festaktes in der Christuskirche der Baptistengemeinde Hamburg-Altona zählten auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Kirsten Fehrs.
Vielen Menschen sage der Begriff Täufer heute kaum noch etwas, dabei habe diese vielfältige Gemeinschaft "große Ideen mit in die Welt gebracht", sagte Steinmeier in seiner Rede. Zentrale Ziele der Bewegung seien individuelle religiöse Freiheit und ein Verlangen nach größerer sozialer Gerechtigkeit gewesen. Ihre Tradition der Gewaltlosigkeit, der Mündigkeit jedes Einzelnen und der Freiheit sei "ein kostbares Erbe", sagte Steinmeier.
Astrid von Schlachta vom Verein "Gewagt! 500 Jahre Täuferbewegung 1525-2025" sagte, ein Anliegen der Jubiläumsfeier sei es, "nicht in der Geschichte stehenzubleiben, sondern ins Heute zu gehen". Die Bewegung stehe seit jeher für die Freiheit des Glaubens und die Ablehnung von Gewalt. "Die Täufer mahnen uns, Freiheit nicht aufs Spiel zu setzen."
Als Geburtsstunde der Täuferbewegung gilt die erste Glaubenstaufe am 21. Januar 1525 in Zürich. Die Täufer setzten sich für radikalere soziale Reformen im Christentum ein als etwa die Reformatoren Martin Luther und Huldrych Zwingli.
Sie traten für eine geschwisterliche Kirche ohne Hierarchie und Klerus ein. Seit dem 16. Jahrhundert wurden die Täufer verfolgt, Tausende starben. Viele Anhänger emigrierten, vor allem nach Nordamerika.
Hauptzweig der Nachfahren der Täuferbewegung sind heute die Mennoniten. Bei ihnen sind die Gemeinden weitgehend autonom, eine kirchliche Ämterhierarchie gibt es nicht. Die Bekenntnistaufe ist für eine Mitgliedschaft keine Bedingung: Wer als Kind getauft wurde und den Mennoniten beitreten möchte, muss sich nicht mehr als Erwachsener taufen lassen. Weltweit zählen die Mennoniten rund eine Million Mitglieder, in Deutschland sind es etwa 30.000.
Eine Abspaltung der Mennoniten sind die Amische oder Amish, die heute vor allem im US-Bundesstaat Pennsylvania leben. Sie sind bekannt für ihr asketisches Leben ohne moderne Technik wie Elektrizität oder Autos und ihre traditionellen Trachten mit Hüten und Bärten für Männer sowie Kleider und Hauben für Frauen. Ihre Gesellschaft ist strikt konservativ, Frauen leben vor allem in der häuslichen Sphäre. Amische heiraten nur innerhalb ihrer Gemeinschaft. Sie zählen etwa 300.000 Menschen.
Ähnlich wie die Amische führen auch die etwa 45.000 Hutterer ein zurückgezogenes Leben. Sie wanderten in großer Zahl aus, heute gibt es hutterische Kolonien vor allem im Mittleren Westen der USA und in Kanada, wo noch vielfach ein Dialekt des Deutschen gesprochen wird, das Hutterische. Traditionell schotteten die Hutterer sich gegen den Rest der Welt ab, eine einfache Bildung schien ihnen ausreichend. Heute öffnen sich einige von ihnen mehr der modernen Welt.
Nicht zu den Täufern im eigentlichen Sinn gerechnet werden die Baptisten - trotz ihres Namens, der vom griechischen "baptizo" für "Taufe" rührt. Auch die Baptisten praktizieren die Erwachsenentaufe. Ihr Pazifismus ist jedoch im Unterschied zu anderen Gruppen nicht so weitreichend, dass sie geschlossen den Wehrdienst verweigern würden.
Sie sind mitgliederstark: Der "Südliche Baptistenverband" ist mit knapp 13 Millionen Mitgliedern die größte Kirche in den USA. Weltweit gibt es schätzungsweise knapp 50 Millionen Baptisten. Der Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden, zu dem nach eigenen Angaben knapp 650 Baptistengemeinden zählen, gibt ihre Zahl für Deutschland mit aktuell 64.000 an.
Im Jahr 2007 entschuldigte sich die Reformierte Kirche der Schweiz bei den Täufern für die erlittene Verfolgung. 2010 legte der Lutherische Weltbund ein entsprechendes Schuldbekenntnis ab.