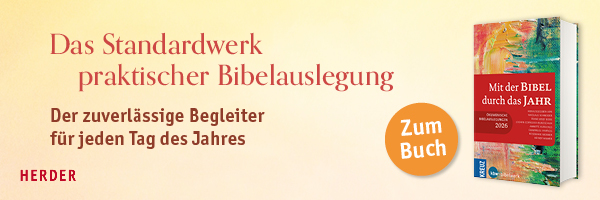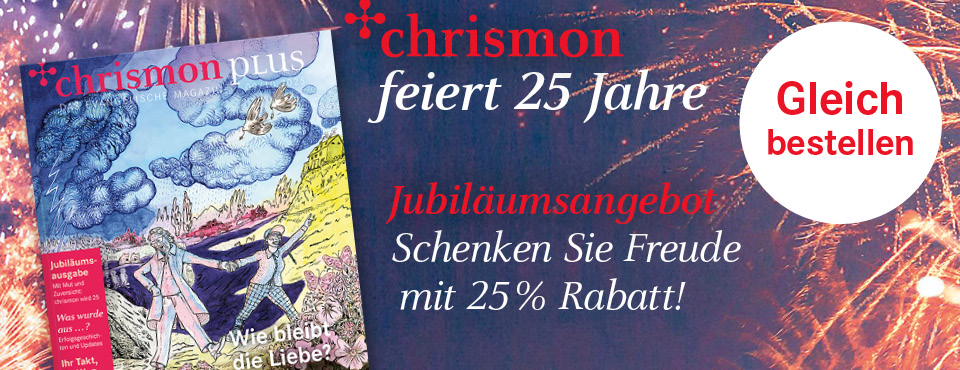Seit mehr als 20 Jahren beschäftigt sich die EKD mit der Problematik, dass nicht nur technische Neuerungen und Erfindungen, sondern auch organisches Material, sprich Pflanzen und Tiere international patentiert werden können. Im internationalen Recht können Lebewesen also nicht nur entdeckt, sondern auch erfunden werden. Nach biblischem Bericht ist dieser Vorgang aber seit der Schöpfung abgeschlossen. Dem Menschen ist lediglich die Züchtung möglich und erlaubt.
Nun legt die Kammer der EKD für nachhaltige Entwicklung eine aktuelle Studie vor: "Biopatente und Ernährungssicherheit aus christlicher Perspektive". Die evangelischen Christen wehren sich gegen zu viele Biopatente.
Längst Patente auf normales biologisches Material
Das bisherige Sortenschutzrecht schützt Pflanzensorten, die ein Züchter entwickelt hat und gibt ihm damit die Möglichkeit, die Entwicklungsarbeit und die Kosten, die ihm entstanden sind über den Verkauf des Saatgutes wieder hereinzuholen. Gegen diese gängige Praxis sei auch gar nichts einzuwenden, sagt Gudrun Kordecki, stellvertretende Vorsitzende der EKD-Kammer für nachhaltige Entwicklung. Das Saatgut ist geschützt. Was dann aus dem Saatgut wächst, gehört dem Landwirt und kann frei vermarktet werden.
Gudrun Kordecki hat an der Studie mitgearbeitet. Foto: Thomas Klatt
Seit 1998 aber gilt zusätzlich die Europäische Biopatentrichtlinie, genauer: "Richtlinie über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen", und das mit weitreichenden Folgen. "Im Extremfall kann dieser Patentschutz vom Saatgut über die angebaute Pflanze über das Erntegut bis hin zum fertig verarbeiteten Lebensmittel reichen", warnt die gelernte Chemikerin Kordecki.
Längst werden dabei Patente nicht nur auf gentechnisch veränderte Organismen erteilt, sondern auch auf normales biologisches Material, das eine Firma lediglich für ihre Zwecke analysiert und entdeckt hat. Biopatente sind zu einem in der Regel von der Öffentlichkeit unbemerkten Massenphänomen geworden. Zwischen 1999 und 2009 wurden beim Europäischen Patentamt mehr als 4000 Biopatente beantragt. Es wurden rund 1300 pflanzenbezogene Patente erteilt, davon etwa 80 für nicht-gentechnisch veränderte Pflanzen. Hinzu kamen 20 Patente auf Nutztiere. Der Verbraucher merkt davon in der Regel nichts, noch nichts.
Immer mehr Saatgut in privater Hand
"Mit den Biopatenten werden grundlegende Weichenstellungen auf dem Lebensmittelsektor gestellt. Biopatente verstärken Marktkonzentrationsprozesse in der Landwirtschaft und damit auch in der Lebensmittelverarbeitung. In dem Moment, in dem beim Saatgut marktbeherrschende Stellungen entstehen, ist es naheliegend, dass Saatgutpreise ansteigen und dass das an den Verbraucher weitergegeben wird", warnt Maren Heincke vom Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau.
Maren Heincke warnt vor zu großer Macht einzelner Unternehmen. Foto: Thomas Klatt
Noch gebe es in Deutschland rund 100 verschiedene Saatgutfirmen, aber global zeichne sich eine immer stärkere Monopolisierung ab. Monsanto, Dupont, Syngenta, Bayer CropScience oder BASF dominieren den Markt. Im Jahr 2009 hatten am internationalen Saatgutmarkt die 10 führenden Unternehmen bereits einen Weltmarktanteil von 73 Prozent. In 90 Prozent aller Sojabohnen und in 80 Prozent aller Maissorten in den USA ist mindestens ein patentiertes Gen von Monsanto enthalten. Dadurch gebe es immer weniger frei zugängliches Saatgut.
"Wenn Lebensmittel und genetische Ressourcen bei Pflanzen und Tieren immer stärker privatisiert werden und immer weniger öffentliche Züchtungsforschung stattfindet, dann werden wir das als Verbraucher auch merken. Es führt zur Machtstellung, wenn Unternehmen ihre Daumen auf die genetischen Ressourcen haben", warnt die Agraringenieurin Maren Heincke.
Patent auf das gesamte Genom von Reis
Die großen Multis melden sehr oft Patente an, um sich die Reche für möglichst viel biologisches Material zu sichern. Sie wollen ihre Claims sichern und mit Global-Patenten Maximalansprüche anmelden. "Zum Beispiel hat die Firma Syngenta ein Patent auf das gesamte Genom von Reis angemeldet. Reis ist eine der Hauptkulturpflanzen der Welt, eines der wichtigsten Nahrungsmittel. Syngenta hatte Gene identifiziert, die das Blühen auslösen. Blühen ist die Voraussetzung dafür, dass man ein Getreidekorn ernten kann. Und die Firma hatte auf über 20 Kulturpflanzen Patente auf diese Blühgene angemeldet", schildert Maren Heincke, Mitautorin der neuen EKD-Studie.
Nach erheblichen internationalen Protesten wurde dieses Universal-Patent zwar nicht erteilt, aber der Vorgang zeige, mit welcher Intensität die Saatgutmultis versuchen, die Welternährung unter ihre Kontrolle zu bekommen. Sich dagegen zu wehren fällt aber oftmals schwer. "Wer klagt denn? Wer hat denn die Ressourcen dafür? Es fängt damit an, dass das Lesen eines Biopatentes juristisches Fachwissen voraussetzt. Im Moment passiert das im Ehrenamt durch die kleine Organisation 'Kein Patent auf Leben'.
Der Einspruch beim Patentamt kostet zwar nur einige hundert Euro, aber dann muss man sehr teure Fachanwälte für die Formulierung der Klage einschalten. Diese Einspruchsverfahren ziehen sich über viele Jahre über mehrere Instanzen hin. Da können locker Kosten von 100.000 Euro anfallen. Und selbst wenn Sie erfolgreich sind bleiben Sie auf den Kosten sitzen. Daher setzen wir uns auch für einen Rechtshilfefonds ein, damit Nichtregierungsorganisationen und Privatpersonen die Möglichkeit haben, Einspruchsverfahren durchzuführen", sagt Heincke.
"Es geht um den Schutz des traditionellen Wissens"
Hinzu komme, dass es keine demokratische Kontrolle beim Europäischen Patentamt EPA gebe. Eine Klage vor einem ordentlichen Gericht gegen ein vom EPA erteiltes Patent ist bislang nicht vorgesehen. Nicht nur, dass die Verbraucher auf Grund der Marktkonzentration langfristig mit steigenden Lebensmittelpreisen rechnen müssen. Schon jetzt werde auch international Schaden durch Biopatente angerichtet.
###mehr-links###
"Es geht um den Schutz des traditionellen Wissens. Indigene Völker nutzen seit undenklichen Zeiten Pflanzen für die Ernährung oder zu medizinischen Zwecken. Wenn jetzt solch ein traditionelles Wissen in die Hände eines Unternehmens gerät, dass darauf ein Patent anmeldet, wird dieses traditionelle Wissen aus dem Allgemeingut eines Volkes in den Privatbesitz eines Unternehmens überführt. Es gab beispielsweise ein Patent auf eine Pflanze in Südafrika, eine Geranium-Sorte, die Wurzel wirkt schleimlösend, ein gutes Hustenmittel, und ein Unternehmen hat darauf ein Patent angemeldet", berichtet Gudrun Kordecki.
Mit dem Effekt, dass diese Pflanze übernutzt wurde und die heimatliche Bevölkerung bei der wirtschaftlichen Nutzung dieser Pflanze leer ausging. Ein Patent ist ein Ausschließungsrecht, das die kommerzielle Nutzung der patentierten Erfindung für einen Zeitraum von mindestens 20 Jahre festlegt, meist aber durch Zusatzanträge weit darüber hinaus. Wenn aber überhaupt, so könne man höchstens den Schöpfergott als Erfinder von Pflanzen und Tieren bezeichnen. Alles andere sei ein menschliches Gemeinschaftsgut, das zum Wohle aller fair und bezahlbar zur Verfügung stehen sollte.
"Nutztiere und Nutzpflanzen sind das Ergebnis der Züchtungsarbeit von 10.000 Jahren. Es ist die Kulturleistung von unzähligen Bauern und Hirten. Es ist ein gemeinsames kulturelles Erbe der Menschheit", mahnt die landwirtschaftliche Fachfrau und Mitautorin der neuen EKD-Studie Maren Heincke.