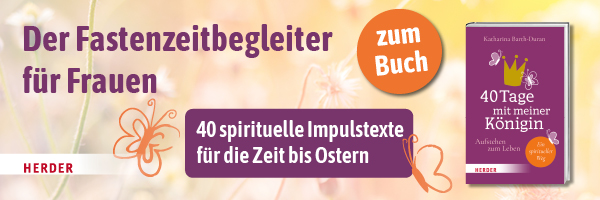Berlin (epd). Die Frauenhauskoordinierung (FHK) hat erstmals bundesweit die Gründe für das Abweisen von Hilfesuchenden untersucht, die bisher nicht systematisch erfasst werden. Wie es in einer Mitteilung des Dachverbandes der Frauenhäuser vom Montag heißt, wurden sowohl Platzmangel und fehlende personelle Kapazitäten als auch gesundheitliche Einschränkungen der Betroffenen oder das Alter der Kinder als verbreitete Gründe genannt, die Gewaltopfer nicht aufzunehmen. Betroffen seien Jahr für Jahr Hunderte Frauen.
Als Gründe für das Abweisen von Schutzsuchenden wurde unter anderem der Wunsch der Frauen genannt, ältere Söhne mit ins Frauenhaus zu bringen. Auch psychische Erkrankungen, Suchtmittel-Konsum, Obdachlosigkeit oder die Einschätzung einer zu hohen Gefährdungslage, für die es im jeweiligen Frauenhaus nicht ausreichend Sicherheitsvorkehrungen gebe, seien ursächlich, heißt es unter Verweis auf eine Kostenstudie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
Im Jahr 2024 haben den Angaben zufolge etwa 13.700 Frauen und 15.300 Kinder Schutz in Frauenhäusern gesucht. Das ergibt eine Hochrechnung aus der aktuellen Frauenhaus-Statistik, die auf Daten zu 6.477 Frauen und 7.224 Kindern aus insgesamt 189 der rund 400 Frauenhäuser in Deutschland beruht.
FHK-Geschäftsführerin Sibylle Schreiber nannte das neue Gewalthilfegesetz, das ab 2032 einen Rechtsanspruch auf einen Schutzplatz gibt, einen wichtigen Meilenstein. „Aber was passiert mit den Frauen, die bis dahin Schutz brauchen und keinen Platz finden?“, fragte Schreiber. Statistiken zu Fallzahlen und Gründen für das Abweisen von Schutzsuchenden seien für das Ermitteln des Bedarfs an Frauenhausplätzen nötig.
Das Gewalthilfegesetz ist Ende Februar in Kraft getreten. Es verpflichtet die Bundesländer dazu, das Hilfesystem im Zeitraum von 2027 bis 2032 auszubauen, sodass es dem „tatsächlichen Bedarf“ entspricht. Diesen müssen die Bundesländer nun ermitteln und bis Ende 2026 eine Ausgangsanalyse und Entwicklungsplanung vorlegen.