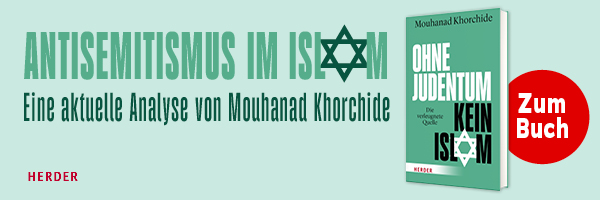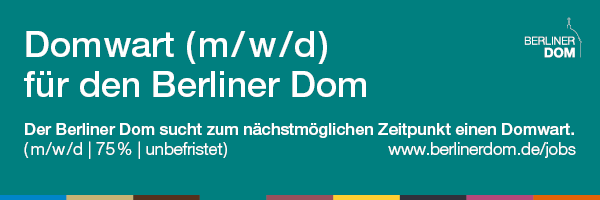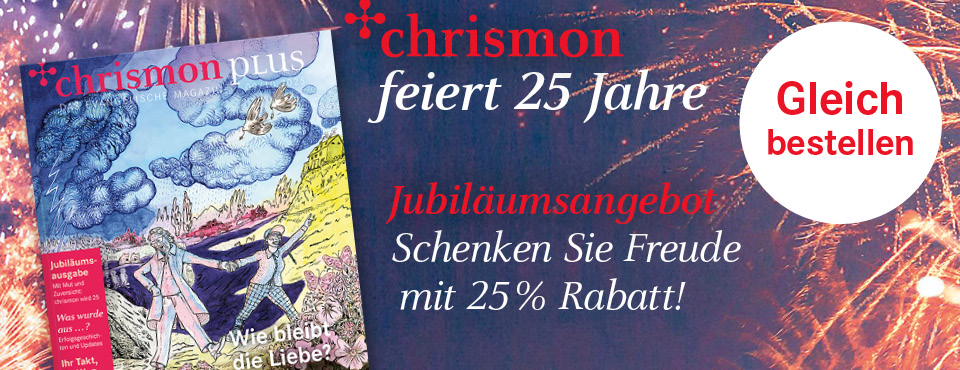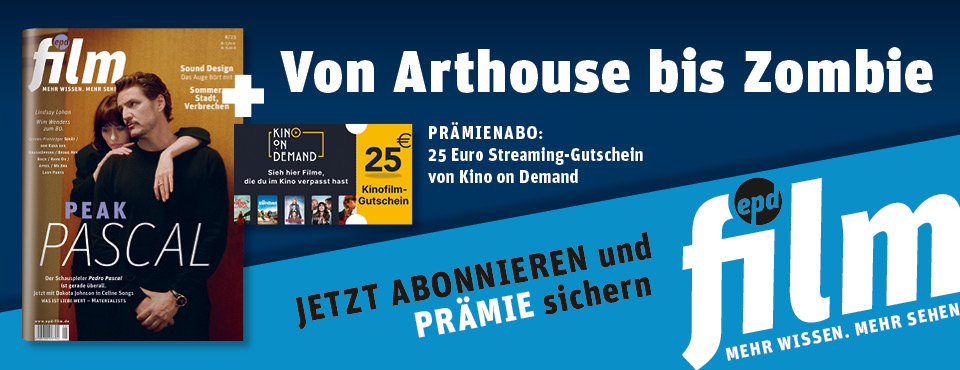Berlin/Frankfurt a.M. (epd). Angesichts des europäischen Streits um die Migrationspolitik rät der Politikberater Gerald Knaus zu bilateralen Abkommen zwischen Deutschland und afrikanischen Ländern. Um die Zuwanderung aus Afrika in die Europäische Union besser zu kontrollieren und zu regulieren, könnten Abkommen mit Herkunftsländern helfen, deren Bürger in Deutschland keine Chance auf Anerkennung als Flüchtling haben, sagte der Vorsitzende der Europäischen Stabilitätsinitiative (ESI) dem Evangelischen Pressedienst (epd).
Knaus gilt als Vordenker des EU-Türkei-Abkommens, das im März 2016 ausgehandelt wurde. Es hatte damals dafür gesorgt, dass die Flüchtlingsrouten über den Balkan geschlossen wurden. Der Politikberater schlägt nun ein Abkommen zwischen Deutschland und dem westafrikanischen Gambia vor, das einen Stichtag festlegt, ab dem die Regierung in Gambia jeden Staatsbürger zurücknimmt, der sich auf den Weg macht. Im Gegenzug müsste sich die deutsche Regierung verpflichten, Gambier, die seit 2016 in Deutschland sind, nicht massenhaft abzuschieben und denen, die hier sind, eine Ausbildung zu ermöglichen. Außerdem müsste Deutschland in die Entwicklungszusammenarbeit mit Gambia investieren. "Bislang gibt es kein einziges Abkommen dieser Art."
Knaus sagte, aus Gambia seien in den vergangenen fünf Jahren 45.000 junge Menschen nach Europa gekommen. Das entspreche fast jedem 50. Bürger des Landes. In den vergangenen zwei Jahren sei die Zahl dieser Migranten aber wieder dramatisch zurückgegangen, weil die Menschen in Libyen festgehalten und misshandelt wurden und danach nach Gambia zurückgeschickt worden seien.
"Ziel einer klugen Politik muss es sein, dass sich Menschen nicht nach Libyen begeben", betonte er. Ein anderes Ziel müsse darin bestehen, die Menschen so schnell wie möglich aus Libyen herauszuholen und zurück in ihre Heimatländer zu schicken, wenn das geht, oder sie in andere Länder zu evakuieren, wo man Asylverfahren einleiten könnte. Die Menschen, die die libysche Küstenwache im Mittelmeer aufgreift, müssten sofort an das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR übergeben werden.
In dem Bürgerkriegsland Libyen befinden sich nach Schätzungen internationaler Organisationen zwischen 700.000 und eine Million Migranten. Laut UNHCR sind dort zudem rund 53.000 Flüchtlinge und Asylsuchende registriert. Etwa 5.600 Flüchtlinge und Migranten seien mit Stand Ende Juni 2019 von libyschen Behörden "unter teils menschenunwürdigen Bedingungen" in sogenannten staatlichen "Detention Centers" festgehalten, heißt es in einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion. Davon befänden sich rund 3.800 in der Nähe umkämpfter Gebiete. Eine unbekannte Zahl werde von Milizen und Kriminellen willkürlich festgehalten.
Nach Informationen des Auswärtigen Amtes wurden in diesem Jahr bis zum 11. Juli gut 3.900 Menschen von der libyschen Küstenwache aufgegriffen. Diese würden in der Regel in staatliche "Detention Centers" gebracht. In der Antwort auf die Kleine Anfrage heißt es darüber hinaus, dass die Bundesregierung Kenntnis habe von "unbestätigten Berichten zu möglichen Zwangsrekrutierungen durch die Konfliktparteien", ebenso zu "möglichen Erschießungen" oder "zur Androhung von Erschießungen". Linken-Parlamentarierin Ulla Jelpke forderte die Bundesregierung auf, die "schändliche Zusammenarbeit" mit der libyschen Küstenwache aufzukündigen.
Derweil kommt es an den europäischen Außengrenzen nach Recherchen des ARD-Politmagazins "report München", der englischen Zeitung "Guardian" und des Recherchezentrums Correctiv EU-Außengrenzen zu Menschenrechtsverletzungen durch nationale Grenzbeamte. So sei in internen Dokumenten der EU-Grenzschutzagentur Frontex zu "schwerwiegenden Vorfällen" die Rede von "exzessiver Gewaltanwendung", "Schlagen mit Draht", "Misshandlung von Flüchtlingen", "Hetzjagden mit Hunden" und "Attacken mit Pfefferspray". Die Vorwürfe betreffen unter anderem Bulgarien, Ungarn und Griechenland. Bei Abschiebeflügen seien auch Frontex-Beamte selbst an Menschenrechtsverletzungen beteiligt, heißt es zudem.
epd hei/mey cez