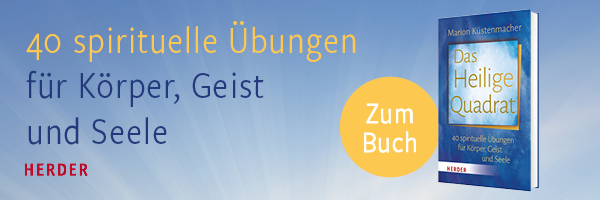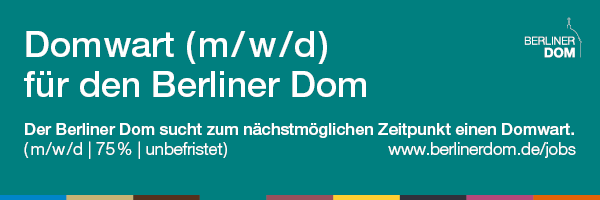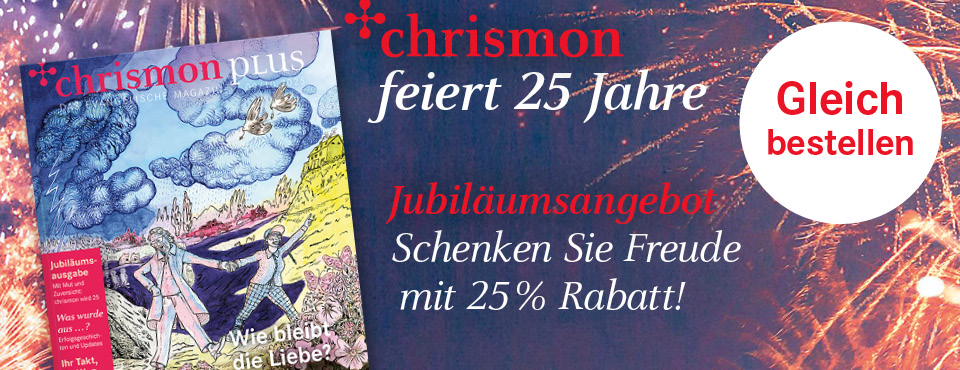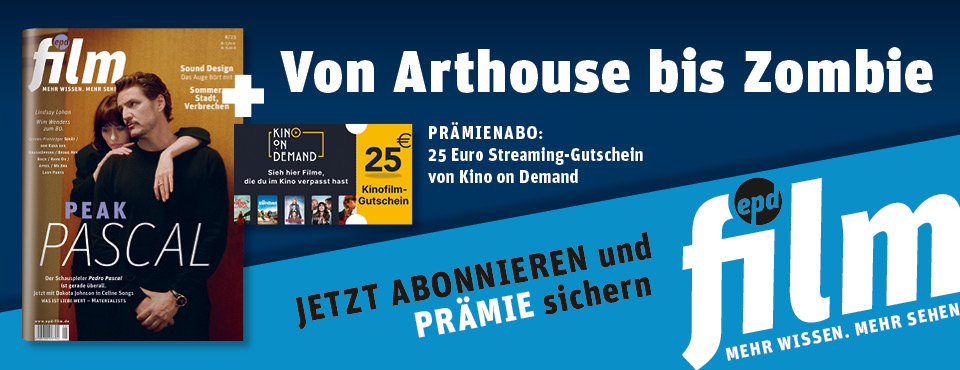Liebe Schwestern und Brüder,
wie viele hatten vor uns darauf gewartet, dass der evangelische Mann mit seiner katholischen Ehefrau zusammen Gottesdienst feiern kann. Dass der evangelische Pfarrer mit dem katholischen Priester Brot und Wein austeilt. Dass man dazugehört, auch wenn man ein bisschen anders glaubt.
Und so stehe ich im Jahre 2008 vor dieser Mauer.
Die Ökumenetür geht tatsächlich auf. Pfarrer Bader und ich liegen uns in den Armen und für einen Moment ist es, als ob die letzten 300 Jahre nichts gewesen wär. Ich habe "ökumenische Gänsehaut". An dieser Tür kommt keiner mehr vorbei. Die Ökumene ist jetzt in Stein gehauen!
Wenn meine evangelische Großmutter jetzt herschauen könnte… sie wär entsetzt. Sie dachte so ähnlich wie die Menschen, von denen Frau Horak eben erzählt hat. Noch in meiner Jugend hätte man sie in eine katholische Kirche prügeln müssen. Von mir als Enkel hat sie wenig gefordert, außer dass ich nicht mit einer katholischen Frau nach Hause komme. Maria, Weihrauch, Fronleichnam, Rosenkranz: alles nichts für meine Großmutter. "Das ist doch katholisch" war keine Feststellung, sondern ein Urteil: Abgelehnt, passt nicht zu uns.
Was würde sie zu dieser Osterkerze sagen? Oder wenn sie gesehen hätte, dass ich einen katholischen Priester in der Kirche umarme?
###mehr-artikel###
An meiner Großmutter wird deutlich, wie sich das Verhältnis unserer Kirchen in den letzten Jahrzehnten verändert hat. Wie viele innere Türen so ganz allmählich aufgegangen sind. Zum Beispiel bei den Weltgebetstagen. Einmal im Jahr beten evangelische und katholische Frauen miteinander und legen biblische Worte aus. Mal in unserer Kirche, mal in der katholischen Kirche.
Was uns heute selbstverständlich ist, haben katholische und evangelische Christen in vielen Begegnungen miteinander - manchmal gegen starke Widerstände in ihrer Gemeinde - erkämpft und mit langem Atem eingeübt. Allein im Rückblick auf meine eigenen Erfahrungen staune ich immer wieder, was sich in der Ökumene alles getan hat.
Zum ersten Mal in einer katholischen Kirche war ich mit meiner Frau. Zunächst war mir vieles fremd. Sitzen-Stehen-Knien … ein merkwürdiger Rhythmus im Gottesdienst. Knien ging gar nicht für mich. Da sträubte sich alles in mir. So protestantisch wie in diesem Moment hatte ich mich noch nie gefühlt.
Aber dann bin ich immer neugieriger geworden und wollte verstehen, was mir so fremd war. Wofür die vielen Kerzen? Warum das Bekreuzigen? Wozu der Weihrauch und die Heiligen drei Könige?
Einiges davon ist mir und vielen evangelischen Christen mittlerweile liebgeworden. Die Osterkerze erinnert an das erste Licht am Ostermorgen. "Christ unser Licht" singen auch wir heute selbstverständlich in unseren evangelischen Osternachtfeiern. Und wie viele evangelische Familien freuen sich über Taufkerzen. Eigentlich ein Symbol aus der katholischen Kirche als Zeichen dafür, dass Christi Licht auf ihrem Weg ist - mittlerweile ein selbstverständliches Zeichen unseres gemeinsamen Glaubens: Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe... so wie es schon im Epheserbrief heißt, den wir eben gehört haben.
"Ihr tut grade so, als ob Ihr nur von uns etwas gelernt hättet", konnte ein katholischer Kollege einmal zu mir sagen, "dabei sind auch wir froh, dass es euch gibt. Von euch kann man lernen, frei zu beten, sich mit Gottes Wort intensiv persönlich zu befassen und sich der Musik von Bach hinzugeben".
Liebe Schwestern und Brüder, dieser ungeteilte Schulterschluss tut nicht nur uns gut, sondern auch der Welt da draußen. Sie braucht uns Christen mehr denn je. Gemeinsam sind wir stärker und stehen wirksam ein für unseren Glauben. Denn Jesus Christus ist ja auch der Herr der Welt. Darum sind wir immer wieder gefordert, für ihn und seine Botschaft einzustehen. Mit Geduld und langem Atem.
So haben wir uns etwa hier in unserer Stadt dafür eingesetzt, dass auch die Leute, die in ihrem Leben gescheitert sind, würdig beerdigt werden. Das soll nicht so billig wie möglich und stillschweigend geschehen. Es ist immer ein Geistlicher unserer Gemeinden dabei. Und bei der Osterfeier auf dem Friedhof wird ihr Name öffentlich genannt. Wie trostlos ihr Leben auch immer gewesen sein muss, auch sie sind Kinder Gottes und werden Gottes Herrlichkeit am Ende sehen!
Ich gestehe: Dies und manches andere in der ökumenischen Zusammenarbeit geht mir auch heute noch unter die Haut.
Aber nicht immer wohlig. Denn mit der Ökumene ist es ein bisschen wie in einer Liebesbeziehung: je mehr man sich aufeinander einlässt, umso empfindsamer wird man, wenn schwierige Zeiten kommen. So geht´s mir jedes Mal, wenn ich als Gast im katholischen Gottesdienst predige. Eigentlich ist es ist immer ein ganz besonderes Erlebnis. Wir beten miteinander, lesen aus der einen Bibel und legen uns gegenseitig die Worte aus. So viel Einklang und blindes Verstehen.
Aber dann kommt immer wieder der Bruch. Ein wenig verloren sitzen wir evangelischen Pfarrer hinter dem Altar in der katholischen Kirche und müssen zuschauen, wie die katholische Gemeinde das Abendmahl alleine feiert. Ohne uns. Denn wir sind nicht eingeladen. Obwohl wir gemeinsam daran glauben, dass unser gemeinsamer Herr jetzt mitten unter uns ist, Sünden vergibt und die Gemeinschaft der Schwestern und Brüder im Glauben an ihn stärkt. Das tut weh! Bei allem Verständnis für andere Sitten und Gebräuche – für mich ist bei der Kommunion die ökumenische Schmerzgrenze überschritten!
Da muss ich ganz, ganz viel Toleranz aufbringen. Dulden und ertragen, was ich bei aller Liebe nicht verstehe. Aushalten, um alles bisher Erreichte nicht einfach wieder aufzukündigen.
Denn die ökumenischen Beziehungen abzubrechen – das wäre ein Tiefschlag für alle, die in ihren Familien so versöhnt miteinander leben. Davon bin ich überzeugt.
Aus vielen offenen Gesprächen mit katholischen Priestern und Gemeindegliedern weiß ich, dass sie unter dieser Trennung genauso leiden wie wir. Mit jedem neuen Papst hoffen sie, dass er diese unsichtbare Mauer um den katholischen Altar niederreißt.
Wie gut, dass wir immer wieder miteinander darum beten können, was Christus seinen Jüngern schon versprochen hat. Als er von ihnen Abschied nahm, sagte er, dass einmal "alle eins sein werden".
Wenn mir die Ökumene weh tut, gibt mir dieser Satz Kraft und Geduld. Weil er verspricht, dass unsere Einheit aus der "himmlischen Welt" kommen wird. Irgendwann einmal werden wir alle gemeinsam am Tisch des Herrn stehen und keiner wird zuschauen müssen.
Wenn wir's nicht erleben, dann unsere Kinder oder Enkel oder Urenkel.
Dabei träumen wir in unseren Gemeinden nicht von einer Einheitskirche. Die Vielfalt soll bleiben. So wie es vier Evangelien gibt, die aus verschiedenen Blickwinkeln von Jesus erzählen, so brauchen wir Kirchen, die miteinander die vielen schönen Seiten unseres christlichen Glaubens bezeugen: Die festlichen Gewänder der Priester, die Ministranten am Altar und die evangelischen Pfarrfamilien und die biblischen Losungen für jeden Tag.
###info-1###
Diese Vielfalt unserer Traditionen und unsere gemeinsame Mitte ist hier in Mosbach auf einen Blick zu sehen. Und so sind alle berührt, die als Touristen durch die Mosbacher Ökumenetür gehen. "Das ist ein starkes Zeichen", können sie sagen, "das macht uns Mut, auch daheim weiterzumachen und nicht locker zu lassen!"
"Das Gemeinsame ist stärker als alles, was uns trennt" - vielleicht gilt diese Erfahrung ja generell. Nicht nur zwischen den Kirchen. Auch zwischen Mann und Frau, Jung und Alt, Arm und Reich: "Das Gemeinsame ist stärker als alles, was uns trennt!"
Denn Jesus Christus ist der Ursprung unseres gemeinsamen Glaubens. Und er ist das eine Ziel, auf das wir zugehen.
Darum lohnt es sich, mit viel Ausdauer und Geduld verschlossene Wände aufzubrechen, zu einander zu kommen und zu finden, wozu Christus uns berufen hat: Unsere Einigkeit im Geist. Amen.